Berühmte Bibliothekar*innen
Teil 1: Johann Wolfgang von Goethe
„In Bibliotheken fühlt man sich wie in der Gegenwart eines großen Kapitals, das geräuschlos unberechenbare Zinsen spendet.“
(Johann Wolfgang von Goethe)

Foto: Wikimedia Commons
Goethes Verwandlungen
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) ist einer der bedeutendsten Dichter Deutschlands und der Welt. Die Fülle der Standbilder, Museen und Sammlungen sowie die Institutionen im In- und Ausland, die seinen Namen tragen, demonstrieren eindrucksvoll, dass wir es mit einem genialen geistigen Schöpfer zu tun haben. Als „geistige Schöpfer“ bezeichnen wir in der bibliothekarischen Fachsprache Schriftsteller, Künstler und Kreative, die ein Werk der Literatur, der Kunst oder der Musik hervorgebracht haben.
Wer mit einer Goethe-Ermüdung kämpft oder denkt, so ein bisschen dichten sei nicht schwer, versuche einfach einmal, ein Drama im Knittelvers zu schreiben, das die literarischen Strömungen des Mittelalters, des Sturm und Drang, der Aufklärung, der Weimarer Klassik und der Romantik verbindet und inhaltlich betrachtet so zeitlos, so kraftvoll ist, dass es noch 200 Jahre nach seinem Erscheinen gelesen, vertont, verfilmt und aufgeführt wird und im Oberstufen-Kanon deutscher Gymnasien fest verankert ist.
Und Faust ist nur das berühmteste Beispiel einer einzigartigen Dichtkunst, die Goethe mit all seinen Verwandlungen zu einem Weltbürger aus Deutschland macht.
Er schlüpfte zeitlebens in viele Rollen und erfand sich ständig neu. Goethe, der Stürmer und Dränger, Minister, Klassiker, Theatermensch, Briefeschreiber, Zeichner, Jurist, Geheimrat, Naturforscher, der Ehemann, Liebende und Vater … und Bibliothekar. Ja, er scheint ein Dutzend Leben gelebt zu haben, und seiner Tätigkeit als Oberaufseher der Herzoglichen Bibliothek in Weimar blieb er beachtliche 35 Jahre treu.
Bildung anno dazumal
Schon als er noch „das Wölfchen“ genannt wurde, kam Goethe in den Genuss des Bücherlesens und war im Elternhaus von den rund 2000 Büchern der väterlichen Bibliothek umgeben. Allerdings sah die frühkindliche Bildung vor 275 Jahren anders aus als heute, wovon das vergnügliche Lesebuch Möglichst Goethe1 erzählt: Im goetheanischen Haushalt bekamen die Kinder Johann Wolfgang und Cornelia Unterricht in Musik, Zeichnen, Griechisch, Latein und Tanzen von Vater Johann Caspar. Für alle anderen Fächer (Französisch, Italienisch, Naturwissenschaften, Religion, Reiten und Fechten) wurden Hauslehrer engagiert. Auf ausdrücklichen Wunsch der Geschwister gab es Kurse in Englisch und Hebräisch. Zur Entspannung las Mutter Catharina mit ihren Kindern heimlich aus dem Messias von Johann Friedrich Klopstock – einen Text, der heutige Leser*innen durchaus fordert.
Die Büchersammlungen, in denen Goethe sich bewegte, wuchsen mit seinen Lebensjahren.
Mit 16 Jahren begann Goethe sein vom Vater initiiertes Jurastudium in Leipzig und steckte die Nase tief in rechtswissenschaftliche Schriften – obwohl er sich viel mehr für die Literaturvorlesungen interessierte und lieber Gedichte schrieb als Rechtssätze auswendig zu lernen.
Nutzer und Bibliothekar zugleich!
1797, da hatte er seiner Heimatstadt Frankfurt und den Studienorten Leipzig und Straßburg längst den Rücken gekehrt, beauftragte Herzog Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach Goethe mit der Oberaufsicht über die Herzogliche Bibliothek (1991 nach seiner Mutter in Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek umbenannt) und dieser nutzte und leitete sie bis zu seinem Tod im Jahr 1832. Unter seiner Ägide verdoppelte sich der Buchbestand auf 80.000 Bände. So wurde sie eine der bedeutendsten Bibliotheken Deutschlands, ein Fixstern der Weimarer Klassik und bis heute ein einzigartiges Archiv dieser Zeit. Goethe betreute nicht nur gewissenhaft die wunderbare Weimarer Bibliothek im Grünen Schloss, er besaß auch eine private Arbeitsbibliothek in seinem Haus am Frauenplan mit fast 5500 stattlichen Bänden. Diese Bibliothek war eine Autorenbibliothek – ein Spezialfall unter den Bibliotheken: Die eines Menschen, der nicht nur Bücher liest, sondern auch selbst welche schreibt und ohne institutionelles Augenmerk auf etwaige Nutzerinteressen sammelt, sondern die Sammlung ausschließlich unter dem Gesichtspunkt des persönlichen Interesses auf- und ausbaut. Goethes Bibliothek ist ein wohl gehütetes Schatzkästchen, aus dem die Interessen ihres Besitzers funkeln.

Foto: Wikimedia Commons, Yale University Library, Beinecke Rare Book and Manuscript Library
Autorenbibliothek
Als er das 70. Lebensjahr erreichte, begann Goethe seine Papiere und seine private Büchersammlung zu ordnen. Der Bibliothekar Goethe brauchte für seine Privatbibliothek einen Bibliothekssekretär! Einen, der sich an seiner persönlichen literarischen und wissenschaftlichen Arbeitsweise orientierte und der es möglichst leicht haben sollte, die gesuchten Bücher aufzufinden. Friedrich Theodor Kräuter arbeitete bereits in der Herzoglichen Bibliothek und Goethe bezeichnete ihn als einen „jungen, frischen, in Bibliotheks- und Archivgeschäften wohlbewanderten Mann“. Kräuter professionalisierte Goethes Büchersammlung zu einer Zeit, in der Bibliothekare „als lebendiger Katalog den Büchern vorgeschaltet“2 waren. Was bedeutete, dass sie, in Ermangelung eines Kataloges, bei der Suche nach einem Buch auf ihr Gedächtnis angewiesen waren. Man stelle sich dies in einer Bibliothek wie der Deutschen Nationalbibliothek vor, mit 53 Millionen Medieneinheiten und einer Magazinaufstellung nach Numerus Currens (fortlaufender Nummer nach Eingang)!
1817 begann Kräuter mit der Betreuung und Neuordnung der Werke aus Goethes Privatbibliothek. Ab 1822 erstellte er den handschriftlichen Katalog Catalogus Bibliothecae Goetheanae (1822-1839), den Christian Theodor Musculus um einige Nachträge ergänzte. Der Catalogus umfasst beinahe 1000 Seiten, nennt alphabetisch die Verfasser mit bibliografischen Angaben, Buchformat und teilweise eine thematische Zuordnung.
Man schreibt Bücher über Goethes Arbeitsbibliothek …
Bereits seit 1888 sollte es ein Buch über Goethes Bibliothek geben – es dauerte aber bis zum Jahr 1958, als der pensionierte Bibliothekar und Altertumswissenschaftler Hans Ruppert einen gedruckten Katalog mit dem Titel Goethes Bibliothek vorlegte. 2022 schließlich verfasste der Literaturwissenschaftler Stefan Höppner einen über 500 Seiten starken Band, der ebenfalls unter dem Titel Goethes Bibliothek erschien und sich kenntnisreich und spannend mit dieser einzigartigen, fast kompletten Büchersammlung und ihrer Geschichte befasst.
Wir erfahren etwas über Goethes Arbeitsweise im Umgang mit seinen Büchern, wie er sammelte, verzeichnete, kommentierte (meist nicht in Marginalien direkt in den Büchern, sondern in eigenen Notizbüchern), aufstellte (nicht nach Numerus Currens!), ordnete, aussonderte und verschenkte.
Wie Goethe wohl über Digitales dächte …
Gespannt darf man sich fragen, was unser Kollege Goethe über die Digitalisierung denken würde und was er zu der rasanten Entwicklung der Künstlichen Intelligenz gesagt hätte, die das heutige Bibliothekswesen in Atem hält. Er war ja ein wahrer Büchermensch. Aber auch ein Stürmer und Dränger in Sachen naturwissenschaftlicher Forschung, Fortschritt und Wissen. Um es uns noch schwerer zu machen, über seine Geisteshaltung zu spekulieren, war er gleichzeitig ein Kritiker der beschleunigten Zeit. Wie der Autor Manfred Osten in seinem Buch „Alles veloziferisch“ oder Goethes Entdeckung der Langsamkeit3 schreibt, verordnete Goethe „dem Denken das ‚langsame und läßliche‘ Verfahren der Natur und der Gefühle, indem er es zurückzubinden versucht an die Vernunft der Gefühle, der Sinne und es aufforderte, die Gegenstände wahrzunehmen. Gegenständliches Denken als Wahrnehmung der Phänomene also […] gegen die Übereilungen des Verstandes“.
Wäre er, der erste deutsche Schriftsteller, dessen Werke vor unerlaubtem Nachdruck geschützt wurden und der die Rechtsidee des geistigen Eigentums erfunden hat, skeptisch gewesen gegenüber Maschinen, die Daten crawlen? Hätte sich betrogen oder gar überflüssig gefühlt als geistiger Schöpfer, wenn eine Software tief in menschliche Gedankenwelten und originelle Ideen taucht und daraus nicht eigene, aber selektiv kompilatorische Geschichten webt?
Auf der anderen Seite, hätte Goethe während der wunderbaren Weimarer Schaffensphase vielleicht ganz gern die ein oder andere Nachricht an Schiller über WhatsApp oder einen anderen Messengerdienst geschickt? Um freundschaftliche Notizen und herbe Kritik von Faust bis zu Wallenstein in Sekundengeschwindigkeit und ohne Briefboten auszutauschen? Und Fotos der noch tintenfeuchten, frisch erdachten Gedichte gesendet?
Wäre die veloziferische Schnelligkeit des Gedankenaustauschs über digitale Medien nicht auch ein kleines bisschen ultra?
Langsamkeit oder Beschleunigung – vielleicht würde er wie sein Protagonist Faust seufzen: „Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust […]“!
So verführerisch die Gedankenspiele auch sind, solange Zeitreisen nicht real sind, werden wir nicht erfahren, was Goethe denkt. Sicherlich aber würde er über diesen Satz von Stefan Höppner, dem Biografen seiner Arbeitsbibliothek, anerkennend nicken:
„Bibliotheken kommen aber nicht nur in der Literatur vor, Literatur ist auch aus Bibliotheken gemacht.“4

Elke Jost-Zell
Elke Jost-Zell ist Bibliothekarin und GND-Redakteurin und bearbeitet Bücher und digitale Medien im Referat Inhaltserschließung der Deutschen Nationalbibliothek
- Engelmann, Christina ; Gyárfás, Cornelia ; Kaiser, Claudia: Möglichst Goethe : ein Lesebuch / München : Deutscher Taschenbuch-Verlag, 2007 ↩︎
- Jochum, Uwe: Bibliotheken und Bibliothekare 1800-1900. Würzburg: Königshausen & Neumann, 1991 ↩︎
- Osten, Manfred: „Alles veloziferisch“ oder Goethes Entdeckung der Langsamkeit.Frankfurt am Main ; Leipzig : Insel-Verlag ↩︎
- Höppner, Stefan: Goethes Bibliothek : eine Sammlung und ihre Geschichte. Frankfurt am Main : Klostermann-Verlag, 2022 ↩︎
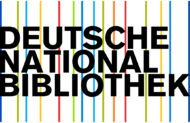




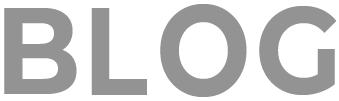
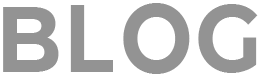
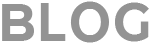
Sehr schöner Artikel!
Wieder mal ein sehr lesenswerter Artikel mit interessanten Fakten von der besten Blogautorin der DNB! 🙂