Leben Flüsse?
Zum Internationalen Tag der Flüsse am 28. September 2025
„Wasser erinnert sich. Nur die Menschen vergessen.“
(Elif Shafak)
Wasser = Leben
Ein Fluss (von althochdeutsch fluz, zu fliozan, fließen) ist ein natürliches, linienhaft fließendes Gewässer auf Landoberflächen.
Beachtet man auf einer Landkarte einmal nur die Gewässer, eröffnet sich ein faszinierend neuer Blick. Die Karte zeigt dann auf einmal ein weit verzweigtes, üblicherweise blau gefärbtes Netz. Die Einzugsgebiete der Flüsse sammeln Fäden, flechten sie zu Strängen, die Verästelungen erinnern an Adern, Venen, ein Gefäßsystem, ein Nervensystem und entfernt auch an die sich immer verfeinernden Wurzelsysteme der Bäume. Wie ihre wassermächtigen Geschwister, die Meere und Ozeane, sind auch Flüsse Urgewalten und entscheiden über das Leben in und um sie.
Die Frage ist: Leben sie? Und wenn sie leben, können sie auch sterben?

Foto: DNB, Elke Jost-Zell
Der Zustand der deutschen Flüsse 2025
Wie geht es den deutschen Flüssen heute, am Internationalen Tag der Flüsse 2025?
Von ihrem Zustand berichtet die FAZ vom 15. September 2025 unter Berufung auf die Angaben der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) in Koblenz und des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) in Magdeburg.
Das Wetter war bisher wechselhaft – der Jahresbeginn ab Februar „extrem trocken und im März und April regnete es wesentlich weniger als sonst, Ende Juni führten die Flüsse verbreitet Niedrigwasser. Der Juli war regenreicher, vor allem im Norden und am Alpenrand. In den Mittelgebirgsregionen ist die Bodenfeuchte weiterhin niedrig […]. Rund 40 Prozent aller Grundwassermessstellen weisen niedrige bis sehr niedrige Werte auf, etwa 60 Prozent zeigen normale Werte. Hohe bis sehr hohe Werte gebe es nur an wenigen Messstellen. […] Im Westen Deutschlands wiesen rund 70 Prozent der Grundwassermeldestände niedrige bis sehr niedrige Werte auf. An 80 bis 90 Prozent aller Flusspegel herrscht zurzeit Niedrigwasser. Kleine Bäche und Flussläufe sind laut dem UFZ ausgetrocknet. Zu der Trockenheit im Sommer sei noch eine Hitzewelle gekommen, so dass sich die Flüsse stark aufgeheizt hatten. Fischsterben sei mancherorts die Folge gewesen. Auch seien vermehrt Blaualgen gewachsen, welche die Gewässer und die drin lebenden Organismen durch Giftstoffe geschädigt hätten. […] Was den am stärksten von Trockenheit betroffenen Regionen helfen würde, sei eine langanhaltende Regenperiode. Etwa ein November, in dem es durchgehend gleichmäßig regne.“
Flusstränen
Der Sommer des Jahres 2022 war der heißeste, der bis dato verzeichnet wurde, und fast alle Flüsse drohten zu sterben. Der Regensegen versiegte im Juni, und die Dürre erstreckte sich über Monate. Getreide zerfiel auf dem Feld, Trockenheit riss den Boden in klaffende Muster. Saharastaub bedeckte im Freien alle Oberflächen. Die Bäume gerieten in Hitzestress und warfen ihre Blätter ab, feine Nadeln rieselten von den Fichten, Kastanienblätter färbten sich vorzeitig braun, Eichen standen kahl, die Rinde vieler Buchen riss auf.
Den Flüssen ging es schlecht. Manche Abschnitte des Rheins waren für die flachen Kähne nicht mehr befahrbar, in Westkanada verendeten laichende Lachse in den Kiesbetten, die Quelle der Themse verlagerte sich 15 Kilometer flussabwärts. Robert MacFarlane schreibt: „Entlang der Elbe tauchen die Hungersteine auf: große Brocken im Fluss, die sichtbar werden, wenn die Wasserstände zum Verzweifeln sinken. Jahreszahlen und Inschriften aus früheren Dürrejahren sind in sie gehauen: 1417, 1473, 1616, 1830. Nahe Děčín, an der tschechisch-deutschen Grenze, erhebt sich ein Stein mit der Mahnung aus dem Wasser: ‚WENN DU MICH SIEHST DANN WEINE‘.“
Vividus
In der mythologischen Geschichte des zehnjährigen Krieges um die antike Stadt Troja bekämpft der griechische Held Achilles den Fluss Skamandros, indem er ihn mit dem Blut und den Leichen der von ihm Getöteten zum Überlaufen bringt. Doch der Fluss ist kein ergeben passives, sondern ein lebendes, empörtes Wesen, das sich bitter wehrt. Wenn Menschen gegen Flüsse kämpfen, geht dies niemals gut aus.
Nicht nur der Fluss Skamandros in der griechischen Mythologie war belebt, viele Menschen wissen, denken und fühlen, dass die Natur ein lebendiger Organismus ist. Ein Wald denkt, Pilze kommunizieren, ein Berg erinnert sich. „Wasser spricht“, schrieb die schottische Schriftstellerin und Nature Writer Nan Shepherd. „Was sagt es?“ fragt sich ihr Kollege Robert MacFarlane.
In seinem Buch Sind Flüsse Lebewesen? (Originaltitel: Is a river alive?) sucht der britische Literaturwissenschaftler und Nature Writer nach einer Antwort: „Wahrscheinlich wussten wir alle schon einmal, dass Flüsse Lebewesen sind. Als Kinder erkundeten wir das ‚Leben um uns herum‘ – im Sinne des lateinischen Wortes vividus, das so viel wie ‚beseelt, lebendig, voller Leben‘ bedeutet. Kleine Kinder leben instinktiv in einer Welt voller geschwätziger Bäume, singender Flüsse und gedankenvoller Berge. Deshalb gibt es auch in vielen Kinderbüchern – etwa in Märchen und Sagen, über Jahrhunderte und Sprachen hinweg – ganz selbstverständlich sprechende, lauschende, gesellige Landschaften.“

Foto: DNB, Elke Jost-Zell
Geisterflüsse
„Geisterflüsse“ werden unterirdische Flüsse und Wasserläufe genannt, die beim Städtebau in Kanäle oder Tunnel gezwängt wurden und die unsichtbar in der Dunkelheit dahinfließen. Man hört noch „ihr leises Flüstern, durch Gullydeckel und Abflussgitter“, wie MacFarlane schreibt. In London gibt es 20 Geisterflüsse, New York war einmal eine Wasserstadt, der West Broadway ein Feuchtgebiet, ein Bach floss von der 5th Avenue bis zu seiner sumpfigen Mündung in Greenwich Village. Renaturierung haucht dem Wasser einst begrabener Flüsse neues Leben ein. Wo sie wieder ans Tageslicht kommen, finden Menschen zu einem entspannteren Leben zurück – Parkanlagen entstehen und laden zum Spazieren ein, das Wasser kühlt im Sommer seine Umgebung herab, die Luftqualität verbessert sich, der Atem wird frei.
MacFarlane erzählt auch Erfreuliches über unsere Isarmetropole: „Als die Stadt München in einer visionären urbanen Neugestaltung die blaue Isar aus der Flutmulde befreite, in die sie zuvor geleitet worden war, und ihr ein breites Flussbett zurückgab, veränderte sich damit das ganze Stadtbild. Heute schnellen im Schatten von Weiden an seichten Stellen Äschen vorbei. Saftige Auen säumen das Kiesufer mit seiner bewegten Kontur, an dem sich die Menschen treffen, spazieren gehen, reden, sich ausruhen, träumen und in Sonne und Fluss baden. Doch nicht die Stadt hat dem Fluss zu neuem Leben verholfen, vielmehr hat der Fluss die Stadt belebt.“
Wasserkörper
MacFarlane schreibt, dass in der englischen Wasserwirtschaft Flüsse, Bäche und Seen als ‚waterbodies‘ bezeichnet werden: „Für uns Briten haben Gewässer also einen Körper. Zu den 40 000 erfassten Wasserkörpern in England, Wales und Schottland müssten wir allerdings noch 65 Millionen hinzuzählen, da auch jeder Mensch ein Wasserkörper ist. Wasser fließt in und durch uns. Bewegen wir uns fort, sind wir Flüsse. Wenn wir sitzen, sind wir Tümpel. Unser Gehirn und unser Herz bestehen zu drei Vierteln aus Wasser, unsere Haut zu zwei Dritteln. Sogar in unseren Knochen findet sich Wasser. Wir schwimmen, noch bevor wir laufen können, drehen uns wie Freitaucher im dunklen Floating-Becken der Gebärmutter.“
„Wasser ist die seltsamste Chemikalie, das größte Rätsel“, sinniert die türkisch-britische Schriftstellerin Elif Shafak in ihrem Roman Am Himmel die Flüsse (Originaltitel: There are rivers in the sky), „zwei seitlich angeordnete Wasserstoffatome, jeweils an ein Sauerstoffatom in der Mitte gebunden. Ein gewinkeltes Molekül, kein lineares. Wäre es linear, gäbe es kein Leben auf der Erde … keine Geschichten zu erzählen. Drei Atome binden sich aneinander und bilden Wasser: H-O-H.“ In ihrem Buch verbinden sich über die Grenzen von Raum und Zeit drei Charaktere mit zwei Flüssen, der Themse und dem Tigris und dazu einem uralten Gedicht – gemeinsam erzählen sie eine Geschichte, durch die über 2000 Jahre hinweg ein winziger, sich erinnernder Wassertropfen fließt.
Fließende Bücher
Flüsse mäandern durch unsere Köpfe und in unserer Literatur. Dies lässt sich durch Surfen und Navigieren mit dem Kompass der Deutschen Nationalbibliothek, ihrem Katalog, beobachten: Allein von 2020 bis heute beschäftigen sich über 1000 Medienwerke verschiedenster Arten mit dem Thema Fluss, und wir finden über 4000 Normdatensätze der Gemeinsamen Normdatei, GND, in die wir tief eintauchen können. In Buchtiteln sind Flüsse sehr beliebt, sowohl in Klassikern wie Unten am Fluss von Richard Adams wie auch in modernen Erzählungen wie Elif Shafaks Am Himmel die Flüsse. Wir finden die Flüsse in wissenschaftlicher Literatur wie der juristischen Hochschulschrift Rechte der Natur – eine rechtsvergleichende Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung der Rechte von Flüssen und Fachliteratur wie in der Aufsatzsammlung Rechte für Flüsse, Berge und Wälder – eine neue Perspektive für den Naturschutz? Und natürlich gibt es sie in Kinderbüchern wie Abenteuer am wilden Fluss und verfilmten Romanen wie Aus der Mitte entspringt ein Fluss von Norman MacLean. Marilyn Monroe besang einen River of no Return (deutsch: Fluss ohne Wiederkehr) in dem gleichnamigen Film und es gab sogar ein Schauspieler mit dem schönen Namen River Phoenix.
Graswurzelbewegungen
„Die großen Flüsse brauchen die kleinen Wasser“
(Albert Schweitzer, 1875-1965)
Es gibt ein eigenartiges Phänomen namens „kollektive Wahrnehmungsverschiebung“, bei dem Naturdezimierung und Schädigung der Ökosysteme über Generationen hinweg als normal angesehen werden, und man das Ausmaß und die Fülle früherer Naturräume nur noch bei Ansicht alter Karten, Fotoalben der Eltern und Großeltern und in Filmen rekonstruieren kann. Vor zwei Generationen spazierten Fußgänger durch Streuwiesen, auf die ein Industriegebiet gebaut wurde, wischten fünfmal so viele Insekten von Autoscheiben und badeten in Flüssen, die heute verunreinigt sind. Für die nächsten Generationen ist dieser Verlust normal, sie erleben weitere Verluste, die für ihre Kinder normal sind, und irgendwann ist nichts mehr übrig von den Naturräumen, abgesehen von handtuchgroßen Vorgärten, Plastiktümpeln für Kleinkinder – und krank(machend)er Natur.
Diese über Generationen kumulierende Amnesie, die die fortschreitende Zerstörung der Umwelt verschleiert, betrifft auch die Flüsse – einst sauberes Wasser wurde gesundheitsgefährdend, das Leben darin schwand, schwimmen darin war ekelerregend und ungesund.
Eine Gegenbewegung sind die Graswurzelbewegungen (grassroot movements) – sie entstehen von unten, aus der Bevölkerung, immer dann, wenn für eine Idee die Zeit gekommen ist, sich in etwas Reales zu verwandeln. Die „kleinen Leute“, lokale Gruppen, indigene Gemeinschaften, sind es, die der drohende Verlust der Natur zum Protest treibt. Die Bewegung umfasst auch die Flüsse – Flussrechte sind die häufigste Form einer neuen Rechtssubjektivität.
Inzwischen stehen die Flüsse im Mittelpunkt der Bewegung. Es gibt eine „Universal Declaration of River Rights“, eine universelle Flussrechteerklärung, in der Flüsse als lebende Entitäten mit fundamentalen Rechten anerkannt werden, darunter dem „Recht, zu fließen“ und dem „Recht, nicht verschmutzt zu werden“.
Lassen wir noch einmal Robert MacFarlane zu Wort kommen:
„Dass Flüsse im Mittelpunkt dieses weitreichenden neuen Denkens stehen, ist nicht verwunderlich. Als eigenwillige, kraftvolle, verehrte und misshandelte Wesen waren sie lange Zeit im Grenzbereich zwischen Geologie und Theologie verortet. Sie schenken uns lebenskluge Metaphern und widersetzen sich allen Versuchen einer allzu eindeutigen Zuschreibung. Flüsse sind mächtige Wesen, so ungebärdig, ungreifbar und radikal anders, dass sie uns Wasser anders denken lassen. Niemals werden wir wie ein Fluss denken können, aber wir werden vielleicht mit einem Fluss denken können.“
Internationaler Tag der Flüsse
Der 2005 begründete Internationale Tag der Flüsse findet am 28. September 2025 statt. Dieser Tag soll eine weltweite Feier der Wasserläufe dieser Welt darstellen, die alljährlich am letzten Sonntag im September stattfindet. Er soll den Wert von Flüssen hervorheben und ist bemüht, das öffentliche Bewusstsein zu erhöhen und die Förderung der Verwaltung von Flüssen auf der ganzen Welt zu verbessern.
Die Reise eines Wassertropfens
In Elif Shafaks Am Himmel die Flüsse findet sich im Anhang eine bezaubernd ungewöhnliche Zeittafel über die Reise des Wassertropfens, der als eines der verbindenden Elemente durch die Geschichte fließt. Im Jahr 630 v. Chr. fällt der Wassertropfen als Regentropfen über Ninive herab und landet im Haar des Königs Assurbanipal, dem Herrscher des Assyrischen Reiches. Er verdunstet, geht zurück in die Erde, erreicht das Grundwasser, kehrt über eine Quelle ins Meer zurück, steigt in die Atmosphäre auf und fällt 1840 als Schneeflocke am Themseufer auf ein neugeborenes Baby. Er schmilzt, gelangt über die Themse ins Mittelmeer, schwappt Jahre später in Istanbul als Welle in dasselbe Gesicht, gerät in eine Wasserflasche am Berg Sindschar, wird in London getrunken und ausgeweint und landet schließlich wieder im Meer.
Eine solche Reise hatte der portugiesische Dichter Fernando Pessoa (1888-1935) vielleicht erträumt, als er schrieb:
„Zwischen Schlaf und Traum
Zwischen mir und was in mir ist
Und was ich vermute zu sein
Fließt ein unendlicher Fluss“
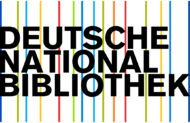




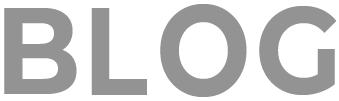
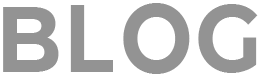
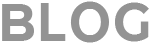
Ein wunderschöner Beitrag, der das überaus interessante Thema Flüsse aus vielen Perspektiven beleuchtet – und dies in einer kurzweiligen Art und Weise! Man möchte mehr darüber lesen!
Wunderbar. Phantastischer Beitrag. Herzlichen Dank. Es ist eine Wonne durch diesen Text zu fließen.