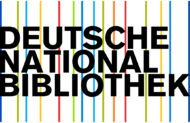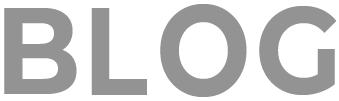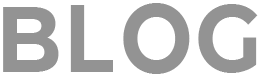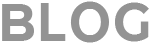Stimmen gegen Klassismus: Twitter im Fokus
Im Rahmen des HERMES-Forschungsstudienprogramms unterstützt die DNB Forschungsprojekte auf Basis ihrer Daten und Bestände, die mit Methoden des Text- und Data-Minings bearbeitet werden. Die Förderung richtet sich dabei vor allem an junge technikaffine Forschende aller Fachgebiete, die sich bereits mit Methoden und Instrumenten der Digital Humanities beschäftigt und praktische Erfahrungen auf dem Gebiet gesammelt haben. Im folgenden Blogbeitrag stellt Hannah Hoffner ihre Studie vor:
Wie sprechen wir in Deutschland über Armut und soziale Ungleichheit? Diese Frage stand im Zentrum meines Projekts, das die Deutsche Nationalbibliothek im Rahmen von HERMES gefördert hat. Untersucht wurde, wie klassistische Sprachmuster – also diskriminierende Darstellungen aufgrund sozialer Herkunft oder Armut – auf der Plattform Twitter sichtbar werden.
Fragestellung
Die Studie ging der Frage nach, welche Narrative in digitalen Debatten rund um Armut dominieren und wie Betroffene und Nicht-Betroffene darüber diskutieren. Besonders interessant war dabei, ob sich klassische Muster der Abwertung – etwa Vorwürfe von Faulheit oder „falschem“ Konsum – auch in sozialen Medien wiederfinden lassen, und inwiefern ihnen solidarische Gegenstimmen entgegentreten.
Wichtig ist dabei: Die Untersuchung versteht Klassismus nicht als das alleinige Problem, sondern als Ausdruck eines tieferliegenden Machtverhältnisses. Im Mittelpunkt steht soziale Ungleichheit selbst – als strukturelle Ursache, die Klassismus hervorbringt.
Datensatz
Grundlage der Analyse war das Twitterarchiv der Deutschen Nationalbibliothek. Es umfasst über zwei Milliarden deutschsprachige Tweets aus den Jahren 2006 bis 2011 und 2014 bis 2023. Der gesamte Bestand ist geschützt und ausschließlich in den Räumlichkeiten der DNB nutzbar; dort wird auch die benötigte Infrastruktur bereitgestellt.
Aus diesem Gesamtarchiv wurden exemplarisch zwei Subkorpora gebildet:
Der Hashtag #IchBinArmutsbetroffen: Seit Mai 2022 haben tausende Menschen darunter öffentlich ihre Erfahrungen mit Armut geteilt.
Die Einführung des Bürgergelds: Die Reform zum Jahreswechsel 2022/23 führte zu intensiven Debatten über Leistungsberechtigung, Arbeitsethik und Solidarität.
Vorgehensweise
Das Projekt kombinierte qualitative und quantitative Methoden. In einem ersten Schritt wurden typische Sprachmuster durch genaues Lesen ausgewählter Diskussionsstränge identifiziert. Dazu gehörten etwa Schuldzuschreibungen („wer will, findet Arbeit“), Neidargumente („die bekommen mehr als wir“) oder Konsumkritik.
Im zweiten Schritt wurde ein digitaler Volltextindex aufgebaut, in dem mehrere hundert Millionen Tweets des Untersuchungszeitraums gezielt nach diesen Mustern durchsucht werden konnten. Mit Hilfe von Schlagwortlisten ließen sich so größere thematische Teilkorpora erstellen.
Darauf aufbauend kamen maschinelle Verfahren wie Topic Modeling und Klassifikatoren zum Einsatz, um diese Diskurse in größerem Maßstab sichtbar zu machen. Schließlich wurden die Ergebnisse erneut qualitativ überprüft und kontextualisiert.
Erste Ergebnisse
Die Auswertung zeigt deutlich: Klassistische Narrative sind in den untersuchten Twitter-Debatten weit verbreitet. Häufig werden Armut und Arbeitslosigkeit individualisiert erklärt – etwa durch das Vorurteil mangelnder Arbeitsbereitschaft oder durch Kritik am Konsumverhalten. Besonders in den Diskussionen rund um das Bürgergeld traten diese Deutungen gehäuft auf.
Gleichzeitig bietet Twitter aber auch Raum für Gegenstimmen. Unter dem Hashtag #IchBinArmutsbetroffen berichteten viele Betroffene von Diskriminierungserfahrungen und forderten mehr gesellschaftliche Solidarität. Hier entstand ein digitaler Raum, in dem Armut nicht länger verschwiegen, sondern kollektiv sichtbar gemacht wurde.
Fazit
Die Studie verdeutlicht, dass soziale Medien nicht nur klassische Vorurteile reproduzieren, sondern auch Orte der Selbstermächtigung und Gegenrede sein können. Sie zeigt zugleich die methodischen Möglichkeiten und Herausforderungen, digitale Diskurse mit modernen Verfahren der Textanalyse zu erfassen.
Gleichzeitig unterstreicht sie: Wer Klassismus analysiert, darf nicht bei diskriminierender Sprache stehen bleiben. Entscheidend ist, soziale Ungleichheit als Ursache sichtbar zu machen – und Wege zu finden, wie Forschung und Gesellschaft ihr wirksam begegnen können.
Hannah Hoffner
Hannah Hoffner wurde 2025 über das Forschungsstudienprogramm des Datenkompetenzzentrums HERMES gefördert. Sie hat für ihre Studie mit dem Twitterarchiv der Deutschen Nationalbibliothek gearbeitet.

HERMES – Humanities Education in Research, Methods, and Data wird gefördert vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt aus Mitteln der Europäischen Union.