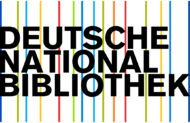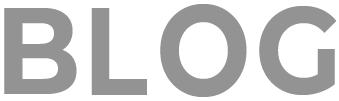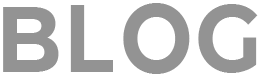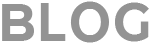The Librarians – Film ab!

Von Zeit zu Zeit laden die Deutsche Nationalbibliothek, die Stadt- und Universitätsbibliothek und die Stadtbücherei Frankfurt am Main zu einem Filmabend zu bibliothekarischen Themen und anschließendem kollegialen Austausch ein.
Zum mittlerweile 5. Treffen, das ausnahmsweise im Deutschen Filminstitut, Filmmuseum am Frankfurter Museumsufer stattfand, kamen Ende Oktober rund 130 Kolleginnen und Kollegen, überwiegend aus Frankfurter Bibliotheken zusammen. Erstmals und aus aktuellem Anlass waren auch Beschäftigte aus Schulbibliotheken eingeladen. Gezeigt wurde der Film „The Librarians“ von Kim A. Snyder. Die Regisseurin war bei dieser Vorführung selbst zugegen.


Der Dokumentarfilm aus dem Jahr 2025 begleitet die Bemühungen von US-amerikanischen Bibliothekar*innen im Kampf gegen Bücherverbote. Von der deutschen Öffentlichkeit mehr oder weniger unbeachtet, werden Bibliothekar*innen in den Vereinigten Staaten seit einigen Jahren von aufgebrachten Eltern bedrängt, Bücher mit bestimmten Inhalten aus Schulbibliotheken zu entfernen. In der sog. „Krause Liste“, die erstmals im Herbst 2021 in Texas veröffentlicht wurde, sind 850 Jugendromane, Bilder- und Sachbücher aufgeführt, die sich überwiegend mit den Themen Rassismus, Sexualaufklärung, Diversität und LGBTQ+ befassen, und nach Ansicht der Erziehungsberechtigten nicht für die Lektüre durch ihre Kinder geeignet sind. Eine Gruppe von Schulbibliothekar*innen stellt sich gegen diese Form der Zensur, um den freien Zugang zu Wissen für Kinder und Jugendliche zu sichern. Dabei ist der Ton ziemlich rau, und eine Reihe der amerikanischen Kolleg*innen sehen sich nicht nur persönlichen Anfeindungen ausgesetzt, sondern haben auch ihren Arbeitsplatz verloren, weil sie sich für die zentralen Werte einsetzen, die die Arbeit einer Bibliothek ausmachen.
Im Mittelpunkt des Films von Kim A. Snyder stehen diese ungewöhnlichen Kämpfer*innen für Demokratie und geistige Freiheit, die vor dem staatlichen Einfluss auf Informationen warnen. Dabei geht es ihnen nicht darum, dass Eltern für ihre eigenen Kinder entscheiden können, welche Bücher diese lesen sollen oder nicht. Vielmehr wehren sie sich dagegen, dass die zumeist christlich-konservativen Gruppen für sich beanspruchen, allgemein gültige Regeln aufstellen zu können. Der Film zeigt dabei auch, dass auf Seiten der Befürworter der Verbote mit allen Mitteln gekämpft wird. So kann man durchaus den Eindruck gewinnen, dass es den Organisator*innen dieser Proteste um mehr geht, als nur ein paar Bücher aus den Regalen zu entfernen. Dies umso mehr als die Proteste überregional gut organisiert und durchaus auch politisch unterstützt sind. Es drängt sich der Verdacht auf, dass es um Einschüchterung, vorauseilenden Gehorsam durch Selbstzensur, finanziellen und psychischen Druck und in letzter Konsequenz auch um den Umbau der Gesellschaft geht: von einer offenen und informierten hin zu einer bevormundeten und uniformierten Gesellschaft.
Und so ist es nicht weiter verwunderlich, dass der auch künstlerisch ansprechende Dokumentarfilm immer wieder historische Filme und Begebenheiten zitiert, wie etwa Fahrenheit 451, eine Episode aus The Twilight Zone oder auch die Bücherverbrennung durch die Nationalsozialisten in Deutschland 1933. Wer mehr darüber lesen möchte, wie seit der Antike politische Ansichten durch die Kontrolle des veröffentlichten Wortes durchgesetzt werden, dem sei das Buch „Burning the Books“ von Richard Ovenden, dem Bibliothekar der Bodleian Library, empfohlen. Richard Ovenden, dessen Buch ebenfalls einen kurzen Auftritt im Film hat, hat im Sommer dieses Jahres bei der Jahrestagung der Conference of European National Librarians (CENL) in Edinburgh einen vielbeachteten Vortrag gehalten, der aufzeigte, wie Bücher und Informationen von der Antike bis heute zerstört, verändert oder missbraucht wurden, um bestimmte politische Haltungen durchzusetzen oder auch zu unterdrücken.

Im Anschluss an die Vorführung des Films führte Johannes Neuer, der Direktor der Deutschen Nationalbibliothek am Standort Leipzig, ein Gespräch mit der Regisseurin Kim A. Snyder, die gerne bereit war, Fragen zu beantworten.
Auch aus den Reihen des Publikums wurden einige Fragen gestellt, bevor die Anwesenden sich unter dem Eindruck des Films, der von einem Zuschauer als „Horrorfilm“ bezeichnet wurde, mit den Kolleginnen und Kollegen austauschen konnten. Und der kollegiale Austausch, auch über die Institutionen hinaus, ist bei diesen Veranstaltungen mindestens so wichtig, wie die Filmvorführung selbst.
Susanne Oehlschläger
Susanne Oehlschläger ist Referentin in der Stabsstelle Strategische Entwicklungen und Kommunikation der Deutschen Nationalbibliothek. Seit Ende 2021 ist sie in dieser Funktion auch Geschäftsführerin (Secretary) der Conference of European National Librarians (CENL).
Alle Fotos von Susanne Oehlschläger