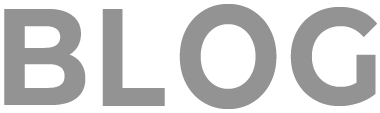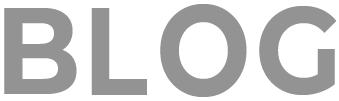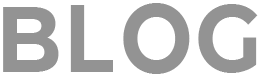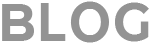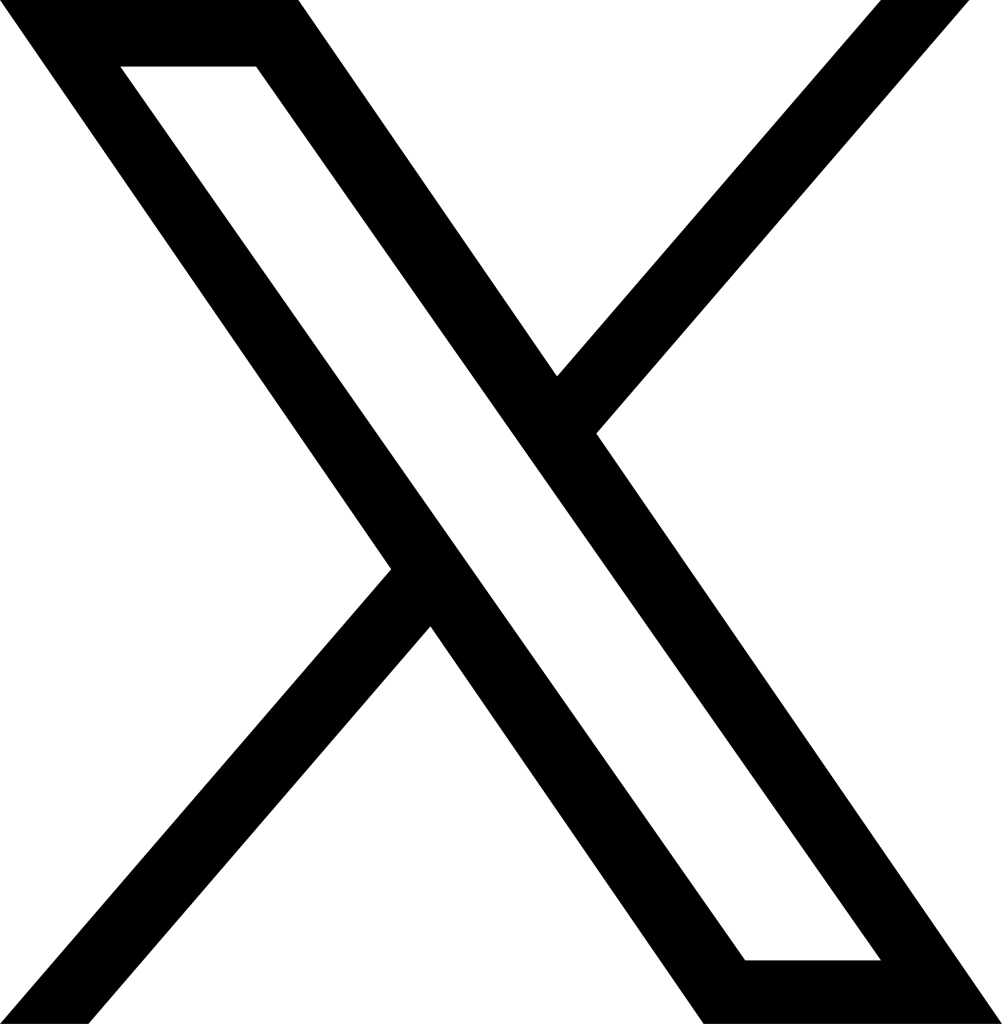Das Gegenwartsmusical im Spiegel des Deutschen Musikarchivs (II)
***
Hier entlang zu Das Gegenwartsmusical im Spiegel des Deutschen Musikarchivs
***
Eine Entdeckungsreise in das Gegenwartsmusical über die Sammlung des Deutschen Musikarchivs (DMA) ließe sich über viele Wege erzählen. Das zeigt sich, wenn man sich systematisch durch die wissenschaftliche Literatur zum heutigen Musical liest. Und davon gibt es inzwischen viel.

Das ist nicht selbstverständlich. Als ich Anfang der 1990er Jahre begann, mich für das Musical meiner Zeit zu interessieren, war auf Deutsch fast nichts mit Substanz und Tiefe zu greifen. Der obligatorische Reclams Musicalführer verschaffte ab 1989 in immer wieder aktualisierten Fassungen einen Überblick übers internationale Kernrepertoire. Weitere Musicalführer folgten. Aber das erste ambitioniertere Buch mit wissenschaftlichem Hintergrund erschien überhaupt erst 2002, Musical. Das unterhaltende Genre. Und sein Fokus war historisch, mit Schwerpunkt auf die Zeit vor 1970. Auf das sogenannte »Goldene Zeitalter des Broadway-Musicals«, das üblicherweise von Oklahoma! (1943) bis Fiddler on the Roof (Anatevka) (1964) gerechnet wird, mit einzelnen, noch heute wichtigen Vorläufern von Show Boat (1927) bis Porgy and Bess (1935). Vielen Werken, angefangen mit My Fair Lady (1956), die noch heute das Repertoire auch der staatlichen deutschsprachigen Bühnen prägen. Aber eben schon 2002 alte Musik waren. Musiktheater aus einer anderen Zeit. (Für einen Überblick über die zentralen Musicals jener Ära, siehe die Liste hier auf S. 135f.)
Auch in den beiden Ländern, in denen sich die Zentren und Triebfedern des Genres finden – der US-amerikanische Broadway und Off-Broadway in New York sowie das britische West End in London – wurden vor den 1990er Jahren vor allem Bücher veröffentlicht, die historische Themen zum Gegenstand hatten. Oder sogenannte Coffee Table Books, Flachware mit vielen Bildern für Fans. Nur noch wenige – ebenfalls primär historisch interessierte – Bände von damals wie Alec Wilders American Popular Song: The Great Innovators, 1900–1950 (1973), Charles Hamms Yesterdays: Popular Song in America (1979), Jane Feuers The Hollywood Musical (1982) oder Rick Altmans The American Film Musical (1987) werden heutzutage noch regelmäßig herangezogen.

Das hat sich seit Mitte der 1990er Jahre spürbar geändert. Die sogenannten Musical Theatre Studies sind heutzutage jedenfalls in den USA und Großbritannien ein anerkanntes geisteswissenschaftliches Gebiet, wie Stacy Wolf, selbst ihres Zeichens Professorin an der Eliteuniversität Princeton, in summarischer Manier in der Fachzeitschrift The Journal of American Drama and Theatre, und Elizabeth L. Wollman vom Graduate Center der City University of New York ausführlich in der Fachzeitschrift Music Research Annual erläutern. Und mit dem Erstarken der Musical Theatre Studies hat auch akademisch ein großes Interesse an dem Musical Einzug gehalten, zu dem man jetzt hingehen kann. Dem Musical unserer Zeit.
Im Sommersemester 2022 unterrichte ich das Thema Gegenwartsmusicals als Titellehre am Institut für Theaterwissenschaft der Freien Universität Berlin. Es handelt sich um einen Lektürekurs, der zugleich Übung zum wissenschaftlichen Exzerpieren ist. Material sind lediglich Überblicksarbeiten zum Gegenwartsmusical, Bühne wie Film. Und schon die Bibliographie dieses Readers umfasst über 50 exzellente Buchauszüge und Fachaufsätze. Das wäre so zu meinen Studienzeiten um die Jahrtausendwende schlicht nicht möglich gewesen. Es gab diese Publikationsfülle nicht. Erst recht nicht in dieser Qualität. Ein erster Indikator, dass wir uns mit der Gegenwart in Sachen Musical in einer ausgesprochen produktiven Phase befinden, die zu derart viel Kommentierung, Einordnung und Diskussion einlädt. Oder wie der renommierte englische Musikwissenschaftler und Musicalforscher Stephen Banfield 2013 unter Rekurs auf die Entwicklung der Musical Theatre Studies schrieb: »The musical has generated a scholarly industry.« (»Das Musical hat eine akademische Publikationsindustrie hervorgerufen.«)
Verschafft man sich einen Überblick über die Perspektiven und Herangehensweisen, wird klar, dass es keinen neutralen, objektivierten Weg gibt, sich einem kulturellen Gegenstand wie dem Gegenwartsmusical anzunähern und von ihm zu erzählen. Alles ist Auswahl und Interpretation. Unsere Anschauung des Gegenstands verändert sich wie unsere ästhetische Erfahrung eines Gemäldes, wenn wir im Museum unseren Standpunkt zu ihm verändern oder es anderswo in einem anderen Kontext hängen sehen. Anderes tritt in den Vordergrund. Anderes wird betont. Andere Schwerpunkte und Zusammenhänge werden sichtbar. So wie jede Neuinszenierung eines theatralen Werks uns dasselbe Stück und doch zugleich etwas ganz Eigenes zeigt, das sich bisweilen gänzlich anders anfühlen kann. Einen das eine Mal kaltlässt und das andere Mal tief berührt, das eine Mal Vergnügen bereitet und das andere Mal intellektuell herausfordert.
So muss man zunächst für sich klären, wie man auf das Gegenwartsmusical schauen und wie von ihm erzählen möchte. Denn je nachdem, wie man sich entscheidet, entsteht eine andere Art Annäherung, ein anderes Bild vom Gegenwartsmusical.
Es lohnt sich daher, sich zu Beginn dieser Entdeckungsreise in diese reiche kulturelle Praxis einen Moment Zeit zu nehmen und die Möglichkeiten zu reflektieren, die vor einem liegen. Denn die etablierten Formen der Annäherung, die man ebenso in den Überblicksdarstellungen zum Gegenwartsmusical wie andernorts in dann thematisch spezifischeren Monographien, Sammelbänden und Fachaufsätzen findet, sind ausgesprochen vielfältig.[1]
Was zugleich für sich schon etwas über das Gegenwartsmusical sagt, dass es derart viele unterschiedliche Zugänge trägt.

Beliebt ist naheliegenderweise, von bekannten Werken und Künstler*innen, insbesondere Komponisten, auszugehen. (Und anders als heutzutage waren die Kreativteams aus Musik, Liedtexten [Lyrics], Libretto [Book], Regie, Choreographie und Bühnenbild damals im »goldenen Zeitalter des Broadway-Musicals« tatsächlich insgesamt eine Männerdomäne, mit wenigen Ausnahmen wie z. B. auf der Textseite Dorothy Fields und Betty Comden oder im Tanz Agnes de Mille und Hanya Holm.) Nicht nur gibt es über nahezu alle klassischen Werke des Musicals von Show Boat und Oklahoma! bis West Side Story und My Fair Lady inzwischen Monographien, ebenso wie über alle kanonischen Komponisten. Im Zuge des Booms der Musical Theatre Studies liegen dergleichen Bücher inzwischen auch zu zeitgenössischen Künstlern wie Stephen Schwartz mit Wicked (2003) oder Lin-Manuel Miranda mit Hamilton (2015) vor. Und vor allem Unmengen Artikel in Sammelbänden und Aufsätze in Fachzeitschriften. Um über einen solch personalisierten Zugang pointierte Schlaglichter auf das zu werfen, was aufgrund seiner besonderen Resonanz und Sichtbarkeit stellvertretend für das Gegenwartsmusical insgesamt steht.
Genauso beliebt ist freilich, anstelle von kanonischen Meistern und Meisterwerken sich mit Durchschnittsware, Allerweltsstücken und Flops zu beschäftigen, die schon quantitativ prägend für das sind, was Musical wie alle Künste in seiner Mehrheit ausmacht.
Andere Autor*innen hingegen nähern sich an über eine Teildisziplin des Gegenwartsmusicals, etwa die derzeit prägenden Entwicklungen in Gesangsästhetik, Tanzstil oder Bühnenbild.
Wieder andere schreiben Sozialstudien, über die in den Werken verhandelten Themen. Oder Abhandlungen über die Veränderung der Produktions- und Arbeitsbedingungen, über die ökonomische Entwicklung, über Stadtkultureinbindung und Tourismus, über die zunehmend interaktive Verzahnung mit Sozialen Medien oder über den im Wandel befindlichen Status von Geschlecht, Sexualität, Religion, Behinderung usw. innerhalb dieser Bühnenkultur. Oder sie analysieren den Einfluss zentraler Akteure und Netzwerke, etwa die immer wieder prägende Rolle einzelner Stars und Produzenten, Journalisten und Fanszenen.
Manch andere versuchen stattdessen, die Eigenart des Gegenwartsmusicals aufzuschließen über die Auseinandersetzung mit den vielen Konventionen dieser Kunstform, darunter
- die standardisierte Werklänge um die 135 Minuten in 2 Akten samt obligatorischer Pause;
- die vielen wiederkehrenden Szenentypen wie Opening Number, I-Want-Song, Conditional-Love-Song, 11-O’clock-Number usw.;
- die eingespielten Produktionsformen wie das autorenseitig typischerweise arbeitsteilige kreative Schaffen oder der traditionell mehrteilige Workshop-Tryout-Preview-Prozess zur Werkentwicklung vor Publikum;
- die Tradition fixer Inszenierungen auch bei Tourneeproduktionen und bei der Lizensierung von Werken zur Produktion in ausländischen Märkten, bei der wie in einem Franchisesystem das Produkt überall gleich aussieht;
- die im scharfen Kontrast dazu stehende Praxis extensiver Werkbearbeitung bei Revivals, die anders als z.B. in der Oper heutzutage üblich selbst die Partitur nicht überrührt lässt, indem Striche, das Auswechseln oder Hinzufügen von Nummern oder Neuorchestrierungen gang und gäbe sind.
Manche nähern sich an das Gegenwartsmusical an, indem sie Chroniken schreiben und Daten zu Parametern wie Laufzeiten, Zuschauern und Erlösen zusammentragen, nach denen in Teilen auch im Gegenwartsmusical noch Erfolg bemessen wird.
Manch andere analysieren die zentralen Trends dieser Praxis im Spiegel regionaler oder globaler Entwicklungen.
Manche erarbeiten Sammlungen von Zeitzeugenberichten von Beteiligten. Andere betreiben Rezeptionsforschung und beschäftigen sich mit der Wirkungsgeschichte einzelner Musicals.

Und wieder andere interessieren sich zuvorderst für die intermedialen Bezüge in einer Kunstform, in der das Gros der Werke Adaptionen von Büchern, Theaterstücken oder Filmen sind, und leuchten die Vergleichsmöglichkeiten aus, die sich so einstellen.
Für hiesige Blogreihe habe ich den Weg zum Gegenwartsmusical über den Genrebegriff gewählt. Es ist nicht nur die Form der Annäherung, die dem typischen archivarisch-bibliothekarischen Zugriff des Ordnens nach Kategorien und Begriffen am nächsten steht. Sie hat nach meiner Erfahrung auch den größten Mehrwert, will man einen Überblick darüber gewinnen, was Gegenwartsmusical ausmacht.
Sich an das Gegenwartsmusical über Genrebegriffe anzunähern, drängt sich einerseits auf, da Genrebegriffe wie
- Musical Comedy
- Book Musical (Integrated Musical)
- Rock Musical
- Megamusical,
- Disney-Musical
- Concept Musical
- Movical
- Jukebox-Musical
- Revisal
- Dansical oder
- Antimusical
allenthalben im Sprechen über Musicals auftauchen. Genre ist schlicht die etablierte Leitkategorie, wenn man Orientierung sucht. Insbesondere auch im alltäglichen Austausch über Musicals, nicht anders, als wenn man sich über Klassische Musik, Jazz oder Popmusik austauscht und von Barock, Bebop oder Hip-Hop spricht.
Andererseits ist Genre keine präzise Kategorie, verglichen etwa damit, zu sagen, Cats hatte seine Deutschlandpremiere am 18. April 1986 im Operettenhaus Hamburg. Sie ist ungleich komplexer, vielschichtiger, flexibler – und hierin durchaus auch immer wieder schwerer zu greifen als mach andere Annäherungsform. Aber hierin eben näher an der Sache selbst, die diese Eigenschaften eben teilt.

Aufbauend auf dem Werkkatalog der schwedischen Band ABBA, ist Mamma Mia! (1999, deutsche Erstaufführung 2002) z. B. der Inbegriff des Jukebox Musicals. Aber es ist zugleich ein Book Musical, da es ganz klassisch chronologisch eine fiktive Geschichte von A bis Z erzählt, die freilich so auch hätte stattfinden können. Aufgrund der Stilistik, die ABBA pflegte, ist Mamma Mia! auch ein Rock Musical. Ferner ist es zumindest in Teilen ein Integrated Musical, insofern Lieder genutzt werden, die Handlung voranzutreiben. In Teilen auch ein Dansical, denn Tanz steht an vielen Stellen im Vordergrund. Und mit einer Musical Comedy hat es ebenfalls viel gemein, da Humor eine große Rolle spielt in dieser lebhaft-turbulenten Geschichte einer alleinerziehenden Mutter, die nicht weiß, wer ihrer drei ehemaligen Liebhaber Vater ihrer Tochter ist und ganz schön in die Bredouille gerät, als jene dies gerne erfahren möchte. Was das Beispiel Mamma Mia! zeigt: Obwohl in Genrebegriffen zu sprechen etwas Gängiges ist, erweist sich Genre beim näheren Hinsehen als eine ausgesprochen anspruchsvolle Kategorie. Schauen wir uns dies am Beispiel der Musik einmal näher an.[2]
Genres sind unauflöslich immer eine Verbindung von einerseits Kontinuität stiftenden Momenten (z. B. musikalische und soziale Konventionen), anderseits Instabilität und hierin doch zugleich eben auch Dynamik verantwortenden Momenten (z. B. Vielfalt der Meinungen und Funktionen). Schon auf ganz basaler Ebene macht es einen großen Unterschied, ob man sich für die erstgenannten oder die letztgenannten Aspekte interessiert – oder beides auszubalancieren versucht. Es ist schon deswegen gar nicht so einfach, zu sagen, was ein Genre ist und was es ausmacht, obwohl über Genres zu sprechen Alltag ist. Für Vertreter der erstgenannten Perspektive schaffen Genres vor allem Stabilität im historischen Wandel und Orientierung in einer für den Einzelnen unüberschaubaren Masse an musikalischer Produktion und musikbezogener Kommunikation. Für Vertreter letztgenannter Perspektive erweist sich diese Stabilität als eine leere Behauptung, die im schlimmsten Fall obendrein alles Individuelle dem Diktat von Genrenormen und der Suche nach Ähnlichkeiten und Ähnlichem opfert. Wieder andere meinen, dass gerade Individualität anders als über vergleichsweise stabile Genrebegriffe gar nicht erst als solche wahrnehmbar und damit beurteilbar wäre.
Welche Position man auch vertritt: Es ist unvermeidbar, dass Musik stets zu Genres gehört, und zugleich unmöglich, Genres quasi rein zu bestimmen. Genres sind Diskursräume, in denen Schnittmengen ausgehandelt werden. Immer wird ein Erwartungshorizont an Musik herangetragen, der nicht erst durch diese Musik entstanden ist. Immer verbleiben Dimensionen im Vergleich von Musik und Erwartungshorizont, die nicht zur Deckung gelangen. Man kann keine genrelose Musik schreiben oder spielen – auch wenn Musiker das auffallend oft behaupten, wenn sie für sich künstlerische Autonomie reklamieren. Zugleich kann man keine Musik schreiben oder spielen, in der ein Genre aufgeht – auch wenn Kritiker gerne von ›Prototyp‹ oder ›Inbegriff‹ eines Genres sprechen und damit so tun, als ob eben dies ginge. Das ist, was Jacques Derrida in seinem grundlegenden Aufsatz Das Gesetz der Gattung »Teilhabe ohne Zugehörigkeit« nennt.
Schaut man genau hin, sieht man u. a. eine Vielzahl an Akteuren, die sich explizit oder durch ihr Handeln konkludent an Genrebestimmungen beteiligen (1). Man erkennt des Weiteren eine Vielfalt an Funktionen der Genrekategorie (2). Und man beobachtet ein immanentes, fortwährendes, unvermeidliches Ringen von Momenten, die für Stabilität sorgen, mit solchen, die für Instabilität, zugleich aber eben auch für Dynamik verantwortlich sind (3).

(1) Eine Vielzahl an Akteuren beteiligt sich an der Bestimmung von Genres. Dass es überhaupt solche Akteure gibt, die sich bisweilen sogar gezielt und bewusst um den Prozess der Genrebestimmung bemühen, zeigt sich z. B. immer dann besonders deutlich, wenn Genres gegen die Nutzung durch Dritte verteidigt werden, deren Handeln als genrefremd angesehen wird. Keineswegs ist dabei gesichert oder vereinheitlicht, wessen Meinung jeweils den Ausschlag gibt. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass es sehr oft einen großen Unterschied macht, wen man wann in welcher Position fragt.
Es existieren zudem große Unterschiede zwischen den Genres. Und auch innerhalb eines Genres können sich Sichtweisen ändern. Die Sache verkompliziert sich dabei nicht nur zusätzlich durch die Vielzahl der Akteure. Akteure können zudem mehrere Positionen gleichzeitig innehaben oder ihre Position wechseln. Ein Labelmitarbeiter kann z. B. gleichzeitig Musiker und Musikhörer sein. Seine Sichtweisen können sich je nach Kontext verschieben, müssen das aber natürlich nicht. Völlig unabhängig von der Frage multipler Akteurspositionen können sich auch schlicht die Ansichten eines jeden Diskursteilnehmers ändern. Die Gruppen der Akteure sind darüber hinaus in sich heterogen. Musikberichterstattung etwa: Fachmedien werden von professionellen Journalisten betreut, aber z. B. im Bereich der Fanzines von Fans. Sie verändern ihre Zusammensetzung fortwährend durch Ausscheiden und Neueintritt alter bzw. neuer Mitglieder.
Es sind also sehr unterschiedliche, dabei in sich heterogene Typen von Akteuren mit durchaus unterschiedlichen Zielen involviert. Verbände und staatliche Institutionen der direkten Kulturpolitik verstehen sich z. B. oft als Institutionen zur Förderung und zum Erhalt von Genres, wie sich mustergültig an der Verankerung des Jazz im öffentlichen Bildungs- und Subventionssystem studieren lässt. Die Genredefinition erfolgt dann im Einklang mit diesen Zielen. Industrielle Akteure hingegen orientieren sich z. B. bevorzugt am Ziel der Umsatzgenerierung und -optimierung.
Aber auch hier ist Vorsicht geboten. Die typischen Akteure dürfen nicht zu schablonenhaft interpretiert werden: Die Rolle der Musikwirtschaft ist z. B. eine hochkomplexe, die auf sehr unterschiedliche Weise das Feld der Genrebestimmung beeinflusst und in keinem Fall im Sinne binärer Opposition – alles kommerziell Relevante absorbierende, Genreidentitäten dabei negierender Mainstream vs. Genrekulturen – gedacht werden kann.
Zumal für alle Akteurspositionen mehrere Ziele gleichzeitig relevant sein können. Einem Musiker mag es um künstlerische Freiheit gehen und zugleich um soziale Relevanz und hinreichende Einnahmen, um von seiner Musik leben zu können. Die Akteure stehen nicht nur in einem komplexen Verhältnis auf der Ebene der Ziele zueinander. Sie können auch Genres unterschiedlich interpretieren, Fans z. B. die Arbeit eines Musikers genreseitig ganz anders zuordnen als es dem Musiker als adäquat vorschwebt. Dann steht es dem Musiker frei, das zurückzuweisen. Je nach Ziel (Genrezugehörigkeit, Prestige, Erlöse usw.) mag ihm das aber nichts nutzen.
Dabei geht es für die Genrebildung nicht zwingend zuvorderst um Fragen von Konsens und Herrschaft, d.h. darum, wer alles mitreden kann und wer sich am Ende wie durchsetzt. Immer wieder gibt es nämlich auch Genres, für die gerade der Mangel an Konsens und vielmehr der offene Streit über ästhetische und soziale Normen identitätsstiftend ist, gerade in avantgardistischeren Kontexten, die hieraus viel an Dynamik und Produktivität ziehen.

(2) Genres dienen überdies ganz unterschiedlichen Funktionen. Die Verwendung von Genrebegriffen ist z. B. eine dominierende Kommunikationsstrategie in der Musikwirtschaft (seit Tonaufnahmen Noten als primäre Distributionsform von Musik abgelöst haben) und in den Kommunikationsmedien, insbesondere im Musikjournalismus. Neben Künstlernamen und Emotionsbegriffen fungieren Genrebegriffe heutzutage mehr denn je als ein Hauptorientierungsmittel in einem für den Einzelnen unüberschaubaren Musikangebot, das nur in Deutschland alleine im Bereich der Tonaufnahmen alljährlich um mehr als 20.000 Veröffentlichungen wächst und Phänomene wie die Hauptplaylist von Spotify kennt, über die aktuell mehr als 40 Millionen Nutzer wöchentlich personalisierte Empfehlungen bekommen.
Dass Genres für Künstler auf Produktionsseite Spielräume und Spielregeln definieren, zu denen sie sich verhalten können, ist jedoch nicht nur in organisatorischer und wirtschaftlicher Hinsicht produktiv. Nach dergleichen Rahmungen und Orientierungspunkten besteht nämlich auch unter den Kreativen selbst eine nicht geringe Sehnsucht in Zeiten, in denen es in den Künsten in vielen Bereichen eben an verbindlichen Grenzen, Dogmatiken und Lehren fehlt, wie schon Theodor W. Adorno konstatierte, da die alten Maßstäbe ihre einstige Autorität verloren haben. Das kann man mit Arthur C. Danto als künstlerische Freiheit feiern. Man kann aber umgekehrt auch den damit einhergehenden Verlust betonen, wie es Jean-François Lyotard tut: »Composers today have the feeling that everything is possible and that they must invent for each work not only its musical form, but the rules of the music«.
Schon Arnold Schönberg kämpfte mit der Erfahrung, dass ihn die in harmonischer Sicht maximale Freiheit der Atonalität an anderer Stelle massiv einschränkte, da es in einem Gestaltungsraum, in dem alles möglich ist, problematisch wird, zu überraschen oder lange dramatische Formen zu gestalten – und komponierte in Reaktion hierauf ein Jahrzehnt lang nicht. Ihm fehlte plötzlich ein Erwartungshorizont, mit dem er operieren konnte. Genau an einer solchen Stelle machen Genres Angebote. Deren regulatorische Kraft kann man schon daran ablesen, wie wenige erfolgreiche Crossoverkünstler vom Schlage eines Leonard Bernstein, David Bowie, Bobby McFerrin, Miles Davis, Herbie Hancock oder André Previn es gibt, die genreseitig ein wirklich weites Betätigungsfeld aufweisen. So steckt in der Anziehungs- und Regulierungskraft des Genrekonzepts für Musikschaffen wie Musikrezeption stets ein ambivalenter Balanceakt zwischen Ermöglichen und Verhindern.
Aber Genres sind vielmehr. Genres konditionieren in mannigfaltigster Weise den sozialen Umgang mit Musik. Sie fungieren in vielen Fällen z.B. als primärer Bezugspunkt kultureller Identität. Genrekonventionen steuern bei allen Akteuren Erwartungen und ermöglichen hierdurch überhaupt erst, zu vergleichen, einen Diskurs zu etablieren und sich nicht in einer disparaten Sammlung von Einzelfällen zu verlieren. Genres schreiben zudem Musik Bedeutung ein, stehen aber immer auch zugleich für Wertzuschreibungen – Genres sind nie neutrale, bloß sachlich beschreibende Begriffe. Genrediskurse schließen dadurch eine Vielzahl sozialer Faktoren ein, einschließlich Rasse, Geschlecht, Religion und Nation. Genrezuordnungen gehen dabei regelmäßig mit weitreichenden, ganz praktischen Konsequenzen einher, von Qualitätsurteilen und Entscheidungen über Zugehörigkeit bis zur Frage, welche Clubs, Festivals oder Playlists einer Musik offenstehen.

(3) Wäre dem nicht schon genug, sind Genres eben stets im selben Atemzug stabil und instabil, gleichermaßen von Kontinuität zu Vorherigem und Veränderungen geprägt. Es gibt wie gesehen keine Musik, die nicht zu einem Genre gehört, keine Musik, die nur zu einem Genre gehört, und keine Musik, in der ein Genre aufgeht. Jeder neue Beitrag verändert jedoch zugleich ein Genre und seine Konventionen. Es gibt umgekehrt Normen, die übergeordnet in einer Vielzahl Genres auftreten, so die Grundregeln kommerziell relevanter Musik: Einfachheit, Repetitivität und Kürze. Dies erschwert gleichfalls die Präzision von Genrebegriffen. Manche Genres werden dabei sehr alt, andere scheinen nur eine Saison, eine Modewelle lang zu existieren. Manche Genres bleiben lange allgemein relevant, manche nur kurz, andere wiederum verlassen nie »einen Status des Marginalen und Prekären«, wie es im Sammelband Prekäre Genres heißt. Gleichzeitig kann sich ein neues Publikum ein Genre erobern und es dabei auch verändern. Oder der originale Musikerkreis wird verdrängt, etwa im Zuge einer musikindustriellen Erschließung. Musiker fusionieren und erweitern aber auch selbst fortwährend bestehende Genres oder spalten Genrespezifika ab und gewichten sie neu, all dies oftmals sogar gezielt als künstlerische Strategie.
Zu diesen drei hier exemplarisch herausgegriffenen Ebenen der Akteure, Funktionen und Dynamiken des Genrebegriffs kommen eine ganze Reihe weiterer grundsätzlicher Herausforderungen hinzu, die Genre zu einer derart fluiden und zugleich attraktiven, da gerade hierin lebensnahen Kategorie machen:
So ist der Genrebegriff z.B. nicht trennscharf geschieden von Begriffen wie Stil, Subkultur, Szene oder Gattung. Sie werden mal synonym, mal partiell überlappend, mal kategorisch getrennt voneinander gebraucht. In unterschiedlichen Gegenstandsbereichen westlicher Musik wie klassischer Instrumentalmusik, Oper, Jazz, Filmmusik und Populärer Musik existieren dabei verschiedene Traditionen und Konventionen im Begriffsgebrauch. Die Lesart dieser Begriffe wechselt aber immer wieder auch innerhalb desselben musikalischen Milieus zwischen verschiedenen Beiträgen.
Darüber hinaus treten Unterschiede auf, je nachdem, ob der Beitrag aus der Musikwissenschaft stammt oder aber eine musikalische Praxis zum Gegenstand hat, aber z.B. aus Sicht von Nachbardisziplinen wie der philosophischen Ästhetik, Soziologie, Kulturwissenschaft oder Geschichtswissenschaft verfasst wurde.

Neben fragilem Begriffsgebrauch stellt die Quellenlage ein weiteres fundamentales Problem der Genreforschung dar: Regelmäßig fehlt es an klar identifizierbaren, expliziten Gründungsdokumenten, Regelbüchern, Kriterienkatalogen usw., was einen zu einer Diskursanalyse, oft gar Diskursrekonstruktion zwingt, die regelmäßig z.B. Oral History einzubeziehen hat. Schon, ab wann ein Genre existiert und wer für seinen Namen verantwortlich ist, lässt sich meist nur ausnahmsweise präzise sagen. Und man muss an dieser Stelle zudem sehr vorsichtig sein, denn allzu oft ergibt eine solche retroaktive Suche vor allem Gründungsmythen und die Behauptung einer quasi reinen Lehre, was das Genre ›eigentlich‹ mal war und wieder sein sollte.
Auch wenn die Namensgebung eine hinreichende, aber keine notwendige Bedingung für die Existenz eines Genres ist, so ist die Vergabe von Genrenamen ein wichtiger Indikator, zeigt sich hier doch oft, dass Akteure das Erreichen eines Aggregatzustands ausmachen, dem eine neu gewonnene Spezifik innewohnt, die etwas unterscheidbar macht – worin auch immer diese Eigenart im Einzelfall liegt. Ob das Neue dann wirklich neu ist, spielt regelmäßig nur eine untergeordnete Rolle, da es sich bei der Namensgebung zuvorderst um eine soziale, vor allem kommunikative Geste handelt.
Im Wechsel und Zusammenspiel der beteiligten Akteursgruppen entstehen fortwährend neue Genrenamen – die dabei keineswegs musikalisch-deskriptiv (Noise Rock, Cool Jazz) angelegt sein müssen, sondern z.B. atmosphärische (Psychedelic, Trance), inhaltlich-thematische (Christian Pop, Christmas Carol), geographische (Charleston, Britpop), sozio-kulturelle (College Rock, Lounge), relationale (Post-Punk, Neo-Soul) oder symbolische (Hair Metal, Baggy) Gesichtspunkte betonen können. Schon in einer eng begrenzten Fallstudie zur elektronischer Tanzmusik im Großbritannien der Jahre 1998 und 1999 förderte Kembrew McLeod mehr als 300 Subgenrenamen unter dem Genremantel der EDM zu Tage, von »abstract beat, abstract drum-n-bass, acid house, acid jazz, acid rave« über »downtempo funk, downtempo future jazz, drill-n-bass, dronecore, drum-n-bass« und »hard chill ambient, intelligent drum-n-bass, intelligent jungle, intelligent techno, miami bass« bis »twilight electronica, two-step, UK acid, UK breakbeat, underground, world-dance«.
Eine zentrale Konsequenz einer solchen Begriffsinflation und -partikularisierung ist natürlich, dass die »normative Bedeutung von Genremodellen und die Halbwertzeit generischer Begriffe« sinkt, wie Peter Wicke schreibt – so wie Genres selbst oftmals nur einen vergleichsweise kurzen Moment im popkulturellen Rampenlicht haben und hiernach vielfach auf deutlich kleinerer Flamme, von einem überschaubaren Kreis von Liebhabern meist dogmatisch deutlich enger ausgelegt, weiterköcheln.
Das Operieren mit Genrebegriffen ist dabei kommunikativ gesehen in jeder Hinsicht ein permanentes Justieren zwischen zu allgemein (z.B. Pop, Jazz) und zu speziell (z.B. Happy Hardcore oder Progressive Low Frequency). Begriffe wie »Metagenre« oder »Subgenre« zeigen dieses Problem an. Und doch ist es notwendig, beide Extreme stets gleichzeitig im Blick zu halten – das Verallgemeinern und das Interesse an der Besonderheit des Einzelfalls –, damit die Kategorie des Genres als Verständnis- und Beschreibungsmittel produktiv sein kann.

Genres bedeuten zu einer bestimmten Zeit für bestimmte Leute etwas Bestimmtes. Das setzt eine erhebliche historische und soziale Sensibilität voraus, gerade wenn man sich Genres in der Vergangenheit annähert. Denn die Gefahr ist groß, dass man aktuelle Genrevorstellungen auf die Vergangenheit projiziert. Diese Gefahr ist im hiesigen Fall noch größer als bei anderen historiographischen Fragen, da Genreformierung, insbesondere die damit einhergehende Konventionsbildung, meist stark retrospektive Züge trägt.
Genres gehen nicht in musikalischen Konventionen auf, sind jedoch keineswegs beliebig in den musikalischen Möglichkeiten, die sie gestatten. Jedes Genre scheint hierbei einen eigenen Toleranzbereich auszuhandeln, bis wohin etwas noch dem Genre als zugehörig angesehen werden kann. Manche sind sehr strikt wie Barbershop Harmony oder Northern Soul, andere nicht. Je genauer man die musikalischen Konventionen eines Genres zu beschreiben versucht, desto exklusiver geht man natürlich vor, in dem man zwangsläufig anfängt, Musik auszusortieren, die anderen wie selbstverständlich als dem Genre zugehörig erscheint. Unterlässt man derart analytische Bemühungen jedoch, ignoriert man die musikalische Praxis, in der regelmäßig ganz bewusst künstlerische Entscheidungen getroffen werden, die z.B. eine Genrezuordnung musikalisch absichern sollen.
So problematisch diese widersprüchliche Situation auch bleibt, so klar ist jedoch, dass solche Annäherungen bei aller Vorsicht analytisch durchaus erreichbar sind: Man denke zum Beleg nur an die Möglichkeit, Genres außerhalb ihres Ursprungskontextes zu parodieren. Ohne benenn- und adaptierbare Ähnlichkeiten, die u.a. eine Wiedererkennbarkeit gestatten, wäre dies nicht möglich. Es gibt etwas, dass sie ausmacht.
So oder so muss man jedoch aufpassen, denn das, was in vielen Genres vorkommt, ist nicht zwangsläufig weniger wichtig für ein bestimmtes Genre als das, was ihm an Besonderem zu eigen ist und auf das man sich allzu leicht konzentriert. Abgesehen davon, dass gerade musikalische Eigenarten besonders selten Genres exklusiv zu eigen bleiben, sondern gerade und oftmals ausgesprochen rasch ihren Weg auch in andere Genrekontexte finden. Man denke z.B. an Bluesphrasierung oder Funkrhythmisierung.
Letztlich muss man Genres relational zueinander verstehen. Genres existieren im Verhältnis zu einem komplexen Netzwerk anderer Genres. Nur ein relationaler Zugriff erlaubt, die Andersartigkeit und zugleich Identität von Genres, nämlich im Verhältnis zu anderen zu verstehen.
Von Genre zu sprechen, heißt also über ein Cluster aus Orientierungen, Erwartungen und Konventionen zu sprechen. Und zwar nicht nur solche, die musikalischer Natur sind. Es steht zwar Musical drüber und es steckt auch zwingend viel Musik drin, wenn wir Musical sagen. Ein solcher Cluster integriert aber nicht nur musikalische, sondern eben unterschiedlichste Faktoren zu einer oft erstaunlich stabilen »Genrewelt«, wie der bekannte Popularmusikforscher Simon Frith einst sagte.

Wenn wir nun in die Genres des Gegenwartsmusicals einsteigen und nach ihrer Rolle im heutigen deutschsprachigen Musiktheater fragen, geht es also nicht um Gruppierungen musikalischer Stilistika. Musicals desselben Genres können sehr unterschiedlich klingen. Über den Genrebegriff ergeben sich vielmehr wechselnde Aspekte, die wir so jeweils in den Vordergrund treten sehen, die Sache ausmachen und die Werke zu einem Zusammenhang zusammenbinden. So wie beim Jukebox Musical z.B. die Arbeit mit bereits vorliegenden Œuvre eines bestimmten Künstlers oder Ensembles. Oder beim Movical das Verhältnis zu einer bestimmten filmischen Vorlage. Oder beim Megamusical ein besonderes Interesse an bühnentechnisch aufwändigen Inszenierungen. Oder bei der Musical Comedy der Einsatz von Humor.
So dynamisch und lebendig Genres zugleich sind, gerade solche, die lange tragen und viele Künstler*innen zum Mitmachen gewinnen. So sehr man auch oft über die Zugehörigkeit von Einzelfällen zu diesem oder zu jenem Genre streiten kann. So vielfältig auch oft die Beiträge im Vergleich miteinander sind, die ein und demselben Genre zugeordnet werden. Genres bilden Identitäten aus, die wir identifizieren können. Und so anders über eine kulturelle Praxis wie populäres Musiktheater sprechen können als über eine bloße Sammlung vermeidlich zusammenhangloser Einzelstücke. Was allein im Fall nur des Broadway des vergangenen Vierteljahrhunderts mehrere hundert Arbeiten wären – oder in einer typischen Spielzeit im deutschsprachigen Theaterwesen zwischen 100 und 150 unterschiedliche Stücke. Elend lange Listen von Namen und Daten entstehen dann. Wie in der jährlichen Statistik des Deutschen Bühnenvereins.
Aber wie klingt das, was sich hinter diesen Namen und Daten verbirgt? Wie sieht es aus? Was will es sein? Und für wen?
Der zentrale Mehrwert, sich dem Gegenwartsmusical über den Genrebegriff anzunähern, ist im Blick auf diese Fragen also jener, dass man hierrüber ein eben zugleich präzises wie reiches Gefühl dafür entwickeln kann, welche Art Musical die Gegenwart prägt und in Deutschland goutiert wird und welche es hier schwer hat, obwohl sie andernorts floriert. Und darüber ein Bild entsteht, was das Musicalrepertoire in Deutschland dieser Tage ausmacht – und sich dann über unterschiedlichen Medientypen wie Tonaufnahmen und Noten in der Sammlung des DMA spiegelt. Ein Bild, das zugleich Schwerpunkte und Vielfalt in dieser künstlerischen Praxis sichtbar macht.
Öffnen wir nun also die Türen zu den Beständen des DMA und schauen einmal, was für Genres des Gegenwartsmusicals sich hier wie zeigen.
***
***
Anmerkungen und weiterführende Hinweise
* Der Autor ist Strategiereferent der Generaldirektion der DNB [Kontakt]. Nebenher forscht und lehrt er universitär, insbesondere interdisziplinär als Privatdozent am Institut für Theaterwissenschaft der Freien Universität Berlin.
[1] Der erwähnte neue Aufsatz von Elizabeth L. Wollman enthält am Ende eine ausführliche, topaktuelle Bibliographie, die einen exzellenten Startpunkt darstellt, wenn man sich motiviert durch diese Blogreihe in die englischsprachigen Musical Theatre Studies einlesen möchte.
[2] Die nachfolgende Bestimmung des Genrebegriffs ist übernommen aus meinem Buch Musikgeschichte ohne Markennamen. Soziologie und Ästhetik des Klavierquintetts, transcript: Bielefeld 2019, S. 145–162. Dort finden sich auch alle wissenschaftlichen Literaturangaben jener Quellen, die in diese Begriffsbestimmung eingegangen sind. Das Buch ist open access (CC-Lizenz) erschienen und frei online abrufbar. Es setzt sich am Beispiel eines Genres Klassischer Musik mit den Fragen auseinander, was für Arten Musikgeschichte man erzählen kann, welche Möglichkeiten es gibt, etwas über Musik zu sagen, und welche Rolle »emotional impact« (ein Begriff aus Paul Guyers A History of Modern Aesthetics) in historiographischer Arbeit spielen kann und darf. Quellenangaben Zitate: Banfield 2013, S. 432; Derrida 1994, S. 252; Lyotard 2009, S. 39; Berger/Döhl/Morsch 2015, S. 8; McLeod 2001, S. 60; Wicke 2010, S. 8; Frith 1996, S. 88.