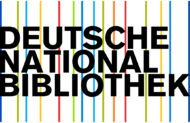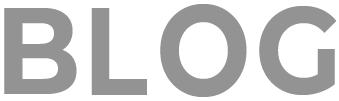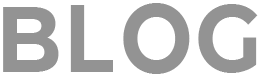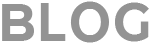Ein Musikregister für Deutschland?
Als Nationalbibliothek ein gutes Netzwerk zu pflegen, bietet den großen Vorteil, dass man regelmäßig über den eigenen Tellerrand schaut und sieht, welche Projekte in der Welt um einen herum realisiert werden. Immer wieder stößt man dabei auf spannende Ideen, die man für die eigene Institution und ihren spezifischen Tätigkeitsauftrag übernehmen kann – oder jedenfalls könnte.
Ein solches Projekt, mit dem wir uns derzeit im Rahmen der Umsetzung der Strategischen Prioritäten 2025–2027 für das DMA beschäftigen, ist das National Recording Registry der Library of Congress (LoC), das Nationale Musikregister der US-amerikanischen Nationalbibliothek. Ein Vorhaben, welches die LoC seit mehr als 20 Jahren fortführt und das sich aus deutscher Perspektive lohnt, einmal genauer anzuschauen.
Denn dieses Register ist auf den ersten Blick an sich nicht mehr und nicht weniger als eine Auflistung von Tonaufnahmen. Eine Art Bestenliste, wie es so unendlich viele in allen Ecken der Musikwelt gibt. Über das nun bald ein Vierteljahrhundert seiner Existenz hat das Label National Recording Registry sich jedoch eine besondere Reputation erarbeiten können. Das liegt am Prestige der Institution, die es verleiht. Aber vor allem an der mehr als guten Gesellschaft, zu der alljährlich Neueinträge hinzugefügt werden.

Die Aufnahmen sollen – so die Vorgabe seitens der LoC – von kultureller, historischer oder ästhetischer Bedeutung sein und das Leben in den USA widerspiegeln. Und genau das schafft das National Recording Registry inzwischen mit einer beeindruckenden Unvoreingenommenheit und Vielseitigkeit.
Entstanden ist das Vorhaben aus dem National Recording Preservation Act aus dem Jahr 2000, einem Gesetz zur Erhaltung nationaler Tonaufnahmen. Aus diesem Gesetz ging die Gründung eines entsprechenden Gremiums (Nationales Gremium zur Erhaltung von Tonaufnahmen, National Recording Preservation Board) hervor, unter anderem mit der Aufgabe, Auswahlkriterien für das Register zu formulieren und eine Auswahl an zu berücksichtigenden Aufnahmen zusammenzustellen. Zu beiden Punkten unten mehr.
Im Januar 2003 wurde die erste Liste veröffentlich. Sie besteht aus 50 Tonaufnahmen von ganz unterschiedlicher Art. Das ist seitdem zu einem prägenden Charakteristikum des National Recording Registry geworden. Wir finden hier frühe Wachswalzen von Thomas Alva Edison, eine ganz frühe Schellack-Aufnahme von 1897 mit „Stars and Stripes“, Klavierrollen für selbstspielende Klaviere mit Ragtimes von und mit Scott Joplin, aber auch die Aufnahmen von Orson Wells „The War of the Worlds“, Martin Luther Kings Rede „I have a Dream“ bis hin zu „The Message“ (1982) von Grandmaster Flash and the Furious Five, einem Meilenstein des HipHop.
Um in das Register aufgenommen zu werden, müssen Tonaufnahmen formale Kriterien erfüllen (zitiert aus der deutschsprachigen Wikipedia):
- Tonaufzeichnungen, die für das National Recording Registry ausgewählt werden, sind diejenigen, die kulturell, historisch oder ästhetisch bedeutend sind und/oder über das Leben in den Vereinigten Staaten informieren oder dieses reflektieren.
- Für den Zweck der Auswahl der Aufnahmen sind „Tonaufnahmen“ als Werke definiert, die aus der Fixierung einer Reihe von musikalischen, gesprochenen oder anderen Tönen resultieren, aber nicht die Klangkomponenten eines bewegten Bildes beinhalten, es sei denn, es steht als autonome Tonaufnahme zur Verfügung oder ist die einzige vorhandene Komponente des Werkes.
- Tonaufzeichnungen können eine einzelne Aufnahme oder eine Gruppe von verwandten Aufnahmen sein, können veröffentlicht oder unveröffentlicht sein, können Musik, Nicht-Musik, gesprochenes Wort oder Rundfunkaufzeichnung sein.
- Tonaufzeichnungen, für die keine Kopie der Aufzeichnung vorhanden ist, werden nicht in das National Recording Registry aufgenommen.
- Es sollte keiner Tonaufzeichnung die Aufnahme in das National Recording Registry verweigert werden, weil sie bereits an anderer Stelle aufbewahrt wird.
- Bis zehn Jahre nach der Erstellung der Tonaufzeichnung ist keine Tonaufzeichnung berechtigt in das National Recording Registry aufgenommen zu werden.
Die Aufnahmen müssen also mindestens zehn Jahre alt sein und sie müssen im Original vorliegen – wenn auch nicht zwangsläufig in der LoC. Es muss aber sichergestellt sein, dass es sich nicht um eine verlorene Aufnahme handelt.
Auf unsere Rückfrage hat uns die LoC geantwortet, dass die mediale Resonanz auf dieses Register von Anfang an groß war, dass aber auch verstärkt die landesweite Berichterstattung gesucht wurde. Die Veröffentlichung einer jeder neuen Liste wird jedes Jahr von Interviews und öffentlichen Veranstaltungen wie Konzerten und Podiumsdiskussionen begleitet.
Während der folgenden Jahre hat die LoC zunächst jährlich weitere 50 Titel in das Register aufgenommen, später dann 25.
Stand 2025 sind 675 Aufnahmen in dem ausnehmend vielseitigen Register verzeichnet. Dieses Jahr (2025) sind u.a. Elton Johns Album „Goodbye Yellow Brick Road“, Keith Jarretts „The Köln Concert“, der Startsound von Windows 95 (Brian Eno) und der Soundtrack von Minecraft (Daniel Rosenfeld) dazugekommen. Der Start-Sound von Windows 95 ist auch die kürzeste Aufnahme, sechs Sekunden lang. Das umfangreichste Dokument sind die gesammelten Reden Lyndon B. Johnsons mit einer Gesamtspielzeit von etwa 850 Stunden. Musik steht gleichberechtigt neben Radiofeatures und Reden. Hauptsache, das Tondokument spiegelt das Leben in den USA in besonderer Weise wider und kann heute noch angehört werden.
Dass Elton John als britischer Künstler hier vertreten ist, illustriert, dass die Zugangshürden abseits der genannten formalen Kriterien hinsichtlich der dem Register zugrundeliegenden Idee davon, was „das Leben in den USA widerspiegelt“, recht weit, insbesondere nicht im engeren Sinne national oder gar nationalistisch gefasst ist. Tatsächlich war Elton Johns Album „Goodbye Yellow Brick Road“ in den USA sehr erfolgreich (und referenziert schon im Titel auf amerikanische Kultur mit „The Wizard of Oz“), aber eben auch in anderen Teilen der Welt. Und nicht nur ist Elton John Brite. Eingespielt wurde das Album in einem Schloss in Frankreich. Gemischt in London. Und das Gros der Texte und Musik ist auf Jamaika entstanden.
2024 hat es z.B. Koji Kondo in die Liste geschafft – der Komponist des Super Mario Soundtracks. Also ein japanischer Komponist, der für ein japanisches Unternehmen Musik geschrieben hat, dessen Bestseller aber Generationen US-amerikanischer Videospiel-Enthusiast*innen geprägt hat.
Wer wählt aus?
Jede und jeder in den USA darf Vorschläge einreichen, welche Titel in die kommende Liste aufgenommen werden sollten. Parallel dazu gibt es ein Gremium aus 20 Fachgruppen, welches ebenfalls Empfehlungen einbringt. Diese Vorschläge werden gleichbehandelt vom oben genannten National Recording Preservation Board bewertet. Die finale Entscheidung, welche Titel in die nächste Jahresliste des Registers aufgenommen werden, trifft letztendlich die Library of Congress.
Können wir ein Musikregister für Deutschland erstellen?
Wir im Deutschen Musikarchiv der Deutschen Nationalbibliothek (DMA) sammeln, archivieren und verzeichnen Musik, die in Deutschland veröffentlicht wurde und machen diese der Öffentlichkeit zugänglich. Allein der bei uns zu Anhören bewahrte Musikbestand ist mehr als zwei Millionen Tonträger stark. Mit unserem bundesweiten Auftrag sind wir zugleich das Diskografische Zentrum Deutschlands. Aber das DMA ist nicht bloß Archiv, Lesesaal und Metadaten. Es ist Spiegel des Musiklebens in Deutschland. Alles ist hier: Die Meisterwerke und der Trash. Das Virtuose und das Amateurhafte. Jede politische Gesinnung und jede ästhetische Neigung. Jeder Stil, jedes Genre und jede gesellschaftliche Gruppe. Alles hat hier seinen Platz. Denn die Sammlung des DMA repräsentiert deutsche Musikkultur, wie sie ist.

Um diese Sammlung lebendig in die Gesellschaft zurückwirken zu lassen und mit möglichst vielen Menschen über Musik ins Gespräch zu kommen, könnte nun die Etablierung eines Pendants zum National Recording Registry für Deutschland ein produktiver Ansatz sein, mit dem sich potenziell die Gesellschaft in ihrer ganzen Breite erreichen ließe. Denn Musik machen viele und hören (fast) alle. Und werden eine Meinung dazu haben, was an Musik für ihr Leben in diesem Land steht.
Aber sollte ein National Recording Registry für Deutschland genauso aussehen, wie es das bei den Kolleg*innen der LoC tut, vom Auswahlprozess bis zu den Auswahlkriterien?
Zahlreiche Stellschrauben
In der Tat gibt es eine große Anzahl an Stellschrauben. Je nachdem, in welche Richtung und wie weit wir diese Schrauben drehen, kann dabei jedes Mal eine ganz andere Liste herauskommen. Hier einige Beispiele:
- Sollten wir in welcher Form auch immer Wert auf Nationalität legen – also z.B. Musik deutscher Bands, deutscher Artists –, oder lieber auf eine „Relevanz für Deutschland“ gehen?
- Welche Kriterien sollten priorisiert werden bzw. welche Relevanz liefert die spannendsten Ergebnisse: ästhetisch, gesellschaftlich, historisch, wirtschaftlich, politisch oder wissenschaftlich?
- Sollten wir ausschließlich Musikaufnahmen verwenden, oder – wie es auch die LoC tut –Sprachaufnahmen miteinschließen? Auch Sätze wie „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten“ oder „Wir schaffen das!“ haben zweifelsohne das Leben in Deutschland geprägt.
- Bei der Lektüre des US-amerikanischen Registers fällt auf, dass sich kaum Aufnahmen finden, die Grund zum Anstoß oder zum Eklat bieten. Sollten wir das in Deutschland ebenso halten, oder sollten auch Aufnahmen Berücksichtigung finden, die zwingend eine Kontextualisierung benötigen (z.B. indizierte Musikveröffentlichungen oder Reden aus der Zeit des Nationalsozialismus)?
- Wie könnte ein Gremium aussehen, welches diese Aufnahmen auswählt? Wer reicht Vorschläge ein, wer bewertet, wer entscheidet?
- Macht der Weg der Auswahl einen Unterschied für die Zusammensetzung der Liste? Dabei könnte ein Weg sein, dass eine große Menge an Personen Vorschläge einreicht, die von einem kleinen Gremium bewertet werden (vgl. National Recording Registry), während ein anderer Weg sein kann, dass ein Gremium Vorschläge einreicht, die dann von einer großen Menge bewertet werden (vgl. Eurovision Song Contest).
- Sind Diversität und Vielfalt wichtiger, oder Verkaufszahlen und Streaming-Daten? Wie stark sollen dabei musikalische Nischen berücksichtigt werden? Suchen wir eher Meisterwerke oder prototypische Beispiele? Ist qualitative Relevanz wichtiger oder quantitative (Charts, Umsatz, Popularität)?
- Ist die zehnjährige „Moving Wall“, die in den USA zu den Auswahlkriterien gehört, sinnvoll? Sollten es mehr Zeit sein, oder weniger? Oder sollte das flexibel gehandhabt werden?
- Wer wäre überhaupt die Zielgruppe für ein solches Register und wie ändert sich diese Gruppe, wenn die Kriterien oder der Auswahlprozess variiert werden?

Hilfe von außen und einige Tendenzen
Um eine erste Idee davon zu bekommen, welche Fragen und Stellschrauben es gibt, und um persönliche Meinungen zu sammeln, welche Schrauben wie gedreht werden sollten, haben wir im Sommer 2025 den Kontakt zu unterschiedlichen Gruppen gesucht, um einige Szenarien durchzuspielen. Eine Gruppe bestand aus Studierenden des Instituts für Bibliotheks- und Informationswissenschaft (IBI) an der Humboldt-Universität zu Berlin. Hier hatten wir die Gelegenheit, eine Seminarsitzung im Rahmen des Moduls „Kulturerbe und digitaler Wandel“ zur Diskussion des Vorhabens zu nutzen, eine Lehrkooperation, die die DNB seit zwei Jahren als Wahlpflichtmodul im Masterstudium des IBI verantwortet und gestaltet.
Die andere Gruppe bestand aus den Teilnehmenden des Collegium Musicum Populare (CMP) der deutschsprachigen Ländergruppe der Vereinigung der Popmusikforschung (International Association for the study of popular music, IASPM-DACH). Das CMP ist ein regelmäßig stattfindender Workshop, der den fachlichen und persönlichen Austausch zwischen Forschenden im Feld der Popular Music Studies fördert. Ziel ist der Austausch zu laufenden Projekten im Rahmen eines ergebnisoffenen Symposiums. 2025 fand das Symposium in Paderborn statt.

An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön, dass wir an diesen Veranstaltungen teilnehmen konnten und ein noch größeres Dankeschön an alle Teilnehmenden, die sich so konzentriert auf unsere Ideen, Szenarien und Rückfragen eingelassen haben und uns durch profunde Kritik und weiterführenden Anregungen darin bestärkt haben, dass wir den Plan, ein deutsches Pendant zum National Recording Registry der LoC zu entwerfen, weiterführen sollten.
Einige Aspekte rückten in diesen ersten Diskussionen wiederholt in den Vordergrund. Etwa, dass sich die Aufnahme in das Register nicht auf Produktion aus dem Raum innerhalb deutscher Bundesgrenzen beziehen sollte, sondern dass der Ansatz der LoC, auf die Wirkung innerhalb dieses Raums zu zielen, ungleich produktiver sei, wenn man über die Beteiligung am Auswahlprozess mit der Gesellschaft ins Gespräch kommen wolle.
Auf eine ähnlich einheitliche starke Meinung trafen wir hinsichtlich der Frage einer Moving Wall. Auch das deutsche Register sollte eine solche Moving Wall setzen, um bei der Auswahl von Aufnahmen weniger von oft kurzlebigen tagesaktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen getrieben zu sein, sondern mit zeitlicher und emotionaler Distanz auf die Aufnahmen schauen zu können, die es in die engere Wahl schaffen.
Weniger eindeutig waren hingegen z.B. die Ansichten dazu, wie ein Gremium und wie der Auswahlprozess auszusehen haben. Beide Wege (viele schlagen vor, wenige entscheiden versus wenige schlagen vor, viele entscheiden) haben ihren Reiz und bergen Gefahren. Eine Tendenz gab es dennoch, nämlich zugunsten des Vorgehens, wie es ähnlich auch die LoC realisiert: Vorschläge kommen sowohl von allen Interessierten, als auch von einer breit aufgestellten Fachgruppe. Die potenziell große Menge an Vorschlägen wird anschließend von einem Gremium bewertet, wobei mehrfach betont wurde, wie wichtig die Diversität dieses Gremiums sei, um sicherzustellen, dass auch die resultierende Liste an Aufnahmen möglichst vielseitig sei. Uneinigkeit bestand freilich darüber, was Diversität in hiesigem Zusammenhang heißen sollte. Ob dieses Gremium lediglich bewertet und Empfehlungen ausspricht (so handhabt es die LoC), oder ob es die finale Liste zusammenstellen soll, wurde ebenfalls unterschiedlich eingeschätzt.
Überhaupt wurde mehrfach die Sorge geäußert, dass Nischen unterrepräsentiert werden könnten, wenn zu großes Augenmerk auf z.B. wirtschaftliche Popularität von Musik gelegt würde.
Die intensivste Diskussion gab es jedoch um die Frage, ob die Liste ausschließlich Musik- oder doch auch Sprachaufnahmen beinhalten sollte. Diese Frage geht Hand in Hand mit der Überlegung, wie eine Kontextualisierung aussehen könne. Dass eine solche im amerikanischen Register fehle, wurde mehrfach negativ angemerkt. Die LoC begleitet die jährlichen Veröffentlichungen jeder neuer Teil-Liste mit Interviews, Konzerten und Podiumsdiskussionen, bei denen es auch um Kontextualisierung geht. Auf der Webseite des Registers ist das nicht (mehr) ersichtlich.
Ein zielführender Vorschlag war, hinter jedem Eintrag im Register einen Text (zum Beispiel im Blog der DNB) zu stellen, in dem begründet wird, warum eine Aufnahme ausgewählt wurde, was sie besonders macht und welche Geschichte mit ihr zusammenhängt. Dabei wurde unterstrichen, dass ein solcher Artikel von – im besten Falle – namhaften Expert*innen der jeweiligen musikalischen Landschaft oder aber der historischen und gesellschaftlichen Zusammenhänge geschrieben werden sollte. Doch auch mit dieser Kontextualisierung gingen die Meinungen auseinander, ob das Register Musik und Sprache gemeinsam beinhalten solle.

Offen und spannend blieb auch die Frage, ob nicht ein Ziel des Vorhabens sein könnte, gar nicht ein einheitliches National Recording Registry für Deutschland zu schaffen. Sondern stattdessen unterschiedliche Auswahlansätze und -kriterien in jährlich fortzuschreibende Listen umzusetzen und den Nutzenden etwa mittels einer entsprechend gestalteten Web-Oberfläche einen Wechsel zu erlauben. Was z.B. offenlegt, inwieweit unterschiedliche Auswahlansätze und -kriterien tatsächlich einen Unterschied machen darin, wie man als Gesellschaft auf die eigene Musikkultur schauen kann. Von E/U über Mainstream/Indie, Professionell/Amateur und Heimisch/International bis physische Tonträger/reine Webkultur.
Wie geht es weiter?
Auch wenn wir noch nicht wissen, welche Gestalt ein deutsches Register für Musik oder für Musik und Sprache am Ende haben wird, wie der Auswahlprozess gestaltet sein wird, wann wir es zum ersten Mal veröffentlichen und wie diese Veröffentlichung aussehen kann – die Vorbereitungen und Vorüberlegungen allein schon machen großen Spaß und es ist toll, zu sehen, wie einfach und zugleich intensiv es ist, mit Menschen zu diesem Thema in stets angeregte Gespräche einzutauchen. Das werden wir in den kommenden Monaten fortsetzen und ausbauen. Denn dieser partizipative Ansatz ist es, der uns besonders wichtig ist – nicht erst bei der Sammlung und Bewertung von Vorschlägen, sondern bereits bei der Konzeption des Vorhabens. 2027 jährt sich Thomas Alva Edisons Erfindung des Phonographen zu 150. Mal. Das wäre eine passende Zielmarke von einiger Sichtbarkeit, um z.B. im Rahmen eines großen Symposiums die vielen bis dahin gewonnenen Erkenntnisse gemeinsam mit Fachleuten aus Gedächtnisinstitutionen, Musikleben, Wissenschaft und Kreativwirtschaft zu sichten, weiterzudenken und zu überlegen, welches die sinnvollsten, spannendsten Szenarien sein könnten, um ein aussagekräftiges Register zu etablieren, und welche Schrauben dafür gedreht werden müssen.