Der Lesesaal und seine Bewohner. Die Rückkehr des Ortes im digitalen Zeitalter
Vorbemerkungen
Der Goethe-Ausspruch „Bücher mögen sich durch Bücher vermehren“ trifft besonders auf die Praxis im Lesesaal zu. Die Lektüre in seinen Räumlichkeiten mündet in der Regel wieder in einen Text. Bibliotheken stellen in diesem Sinne ein Reservoir an Gedanken dar, aus dem Teilstücke herausgelöst und meist modifiziert in neue Zusammenhänge einfließen. Es ist deshalb nicht abwegig, den Lesesaal als „Schreibwerkstatt“, „Denkfabrik“ oder „intellektuellen Maschinenraum“ zu bezeichnen.
Es stellt sich indessen die Frage, ob die Arbeitsräume in der Bibliosphäre im virtuellen Zeitalter noch erforderlich sind. Wenn man ihre Funktion auf die Literaturversorgung reduziert, wird der Weg zum Bücherhaus durch den Fernzugriff auf lizenzierte elektronische Medien und digitalisierte Druckwerke in vielen Fällen überflüssig. „Seine elektronische Entgrenzung übersteht der Lesesaal allerdings ganz offensichtlich gut und behauptet sich gegenwärtig als Raumkonzept ohne Misere“, befindet der einstige Direktor der Universitätsbibliothek Leipzig Ulrich Johannes Schneider. Zwar dienen die Bücherregale oftmals nur noch als Kulisse der bildschirmbezogenen Tätigkeit, doch wird der Lesesaal aufgrund seiner Arbeitsmöglichkeiten und seines sozialen Charakters weiterhin geschätzt, wie im Folgenden ausgeführt werden soll.

Der Lesesaal in seiner Entwicklung
Einen frühen Vorläufer des Lesesaals stellen die spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Pultbibliotheken dar, welche die Lektüre vor Ort durch das Anketten der ausgelegten Bände erzwangen. Die Saalbibliotheken des 17. und 18. Jahrhunderts waren hingegen nicht für die Nutzung der Bestände innerhalb des Gebäudes ausgelegt und erfüllten vorwiegend repräsentative Zwecke. Erste Lesezimmer wurden im späten 18. Jahrhundert eingerichtet. In der Regel handelte es sich um nachträglich geschaffene Räume provisorischen Charakters. Aus Sorge vor der Feuergefahr blieben sie häufig unbeheizt und ohne künstliche Beleuchtung.
Die moderne wissenschaftliche Gebrauchsbibliothek mit ihrer Dreiteilung in Lesesaal, Magazin und Verwaltungsbereiche entstand erst Mitte des 19. Jahrhunderts. Seither fanden Leuchten, Heizungsanlagen, Lüftungssysteme, Toiletten und Garderoben Einzug in die Bücherhäuser, die nunmehr für den Aufenthalt von Menschen konzipiert wurden. In den 1880er-Jahren setzte sich in den wissenschaftlichen Großbibliotheken des Deutschen Reiches schließlich die frei zugängliche Lesesaalhandbibliothek durch, welche allgemeine Nachschlagewerke, einschlägige Lehr- und Handbücher sowie wichtige Zeitschriften und Quellensammlungen beinhaltete. Ein Jahrzehnt später gingen im Zuge der Bücherhallenbewegung die ersten Volksbüchereien zur Errichtung von Lesesälen nach dem angloamerikanischen Vorbild der Public Library über.

Der Lesesaal bildet oftmals das repräsentative Zentrum der Bibliothek. Zu den „markantesten kollektiven Erinnerungsorten westlicher Geistesgeschichte“ zählen die monumentalen Kuppellesesäle der Bibliothek des British Museum in London (1852-1857), der Bibliothèque Nationale in Paris (1857-1867) und der Library of Congress in Washington (1888-1897). Der Rundlesesaal wird mit dem enzyklopädischen Ideal eines bruch- und randlosen Wissens assoziiert. Seine Kuppel fungiert als Würdeform und lehnt sich an die Sakralarchitektur an, um die Bibliothek auratisch aufzuladen. Der nüchternere rechteckige Lesesaal mit flacher Decke wurde im 20. Jahrhundert allerdings zumeist für zweckmäßiger erachtet. Zudem setzte ausgehend von den USA eine Entwicklung zu Fachlesesälen als Reaktion auf die Spezialisierung der Wissenschaften und die steigenden Leserzahlen ein. Daneben wurden an zahlreichen Bibliotheken Speziallesesäle für einzelne Bestandsgruppen wie Handschriften, Periodika oder Mikroformen eingerichtet.

Die Auflösung des tradierten Lesesaalkonzepts jenseits der Präsenzbibliotheken ging mit der Entwicklung zur Freihandaufstellung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts einher. Anstelle eines großen Nutzerraums traten dezentral über das Gebäude verteilte Arbeitsplätze. Die Vermischung von Buchbeständen und Lesebereichen ist inzwischen zum dominierenden Raummodel in Bibliotheken geworden. Allerdings findet der zentrale Lesesaal ungeachtet seines Funktionsverlusts infolge der weitgehenden Abkehr von der Magazinbibliothek in Bauprogrammen nach wie vor Berücksichtigung. „[D]er schon häufig totgesagte klassische Lesesaal bildet oft wieder das Herzstück der neuen Bibliothek, weil seine Arbeitsatmosphäre so beliebt ist“, bemerkt der ehemalige Direktor der Herzogin Anna Amalia Bibliothek Michael Knoche. Der Leiter der Universitätsbibliothek Dortmund Joachim Kreische schreibt gar von der „spektakuläre[n] Wiederkehr des zentralen Lesesaals als Ort des konzentrierten Lesens“.
Der paradoxe Umstand, dass mit dem Anbruch der digitalen Moderne eine Konjunktur des Bibliotheksbaus einsetzte, mag ebenso Verwunderung hervorrufen wie die tendenziell steigenden Nutzerzahlen in Lesesälen. Vielerorts übersteigt die Nachfrage nach Arbeitsplätzen das vorhandene Angebot. Etliche Bibliotheken reagieren auf den Leserandrang mit dem Rückbau von Regalen zugunsten von Schreibtischen. Auf den Nutzungsdruck wurde von berufener Seite mehrfach aufmerksam gemacht. So stellt Ulrich Johannes Schneider einen weltweiten „Ansturm auf Lesesäle“ fest. Wilhelm Hilpert und Stephan Schwarz, Leiter der Abteilungen Benutzungs- und Lesesaaldienste an der Bayerischen Staatsbibliothek in München, teilen diese Beobachtung: „Die Lesesäle großer wissenschaftlicher Bibliotheken erfreuen sich beim Publikum einer nie da gewesenen Beliebtheit.“ Michael Knoche pflichtet seinen Kollegen bei: „An fast keiner deutschen Hochschulbibliothek reicht die Kapazität aus, um allen wissensdurstigen Studenten einen Arbeitsplatz anzubieten.“

Vier Gründe für den Lesesaalbesuch
1. Die Atmosphäre des Lesesaals
Von Lesesälen geht bisweilen eine auratische Ausstrahlung aus, die insbesondere auf die architektonische Qualität, die verschwenderischen Raumhöhen, die speziellen Lichtverhältnisse und die spezifische Akustik zurückgeführt wird. Die großen Denkräume evozieren mitunter eine geradezu sakrale Atmosphäre. Der österreichische Schriftsteller Joseph Roth schreibt von der „tiefe[n] Andacht, die alle lesende Menschen in der Bibliothek frommen Betern in einer Kirche ähnlich machte“. Auch der Germanist Peter von Matt stellt fest, dass im Lesesaal einer großen Bibliothek „das Schweigen kultischen Charakter“ habe. Zu der erhabenen Stimmung trägt die Inszenierung der Büchersammlung als Tempel des Wissens bei. Die zeitliche Dimension des Lesesaals, in dem sich die geisterhafte Präsenz früherer Besucher zu erhalten scheint, verstärkt diesen Eindruck. „So, wie sich die Aura sakraler Orte über die Jahrhunderte mit den emotionalen Überschüssen und Erwartungshaltungen der Gläubigen angereichert haben mag, ist in den Lesesälen die Denk- und Lesearbeit von Millionen Lesern atmosphärisch zu spüren“, befindet die Literaturwissenschaftlerin Evelyne Polt-Heinz.
Als besonderes Merkmal des Lesesaals wird seit Generationen dessen gedankenschwere, bedächtige Ruhe hervorgehoben. So macht die Schriftstellerin Ingeborg Bachmann auf die „Stille der feierlichen Buchstabenabspeisung“ dieses Ortes aufmerksam. Peter von Matt knüpft an das Stimmungsbild an, indem er die Frage aufwirft: „Gibt es ein dröhnenderes Schweigen als in einem akademischen Lesesaal?“ Eskapistische Elemente spielen in diesem Zusammenhang auffallend oft eine Rolle. Der Lyriker Louis MacNeice beschreibt den Lesesaal des British Museum als „verschlossen in sich selbst, in eine Welt, die still und sicher ist“. Der Philosoph Eric Bolle wiederum weist auf die „Gemeinschaft der Leser“ hin, „die Zuflucht in der Stille, im Schweigen suchen“. Offenkundig ist manchen dieser intellektuellen Sammlungsräume also eine einnehmende Stimmung zu eigen, für die ein nicht unbeträchtlicher Teil der Eintretenden empfänglich ist.

2. Der Lesesaal als Haltepunkt einer flüchtigen Gegenwart
In Anbetracht der Omnipräsenz virtueller Umgebungen liegt der Gedanke nahe, den Zuspruch für Lesesäle als Ausdruck eines Bedürfnisses nach sinnlich erlebbaren Orten und kultureller Selbstvergewisserung zu verstehen. Seit einigen Jahren wird Bibliotheken eine wichtige Rolle als lebensweltlicher Haltepunkt einer fluiden Gegenwart im Fachdiskurs zugeschrieben. Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz Hermann Parzinger erklärt ihre Attraktivität aus dem Umstand, „dass der digitale Mensch sich immer mehr nach analoger Gesellschaft und realen Orten sehnt“, während die Publizistin Nora S. Stampfl die Bibliothek als „Anker in der physischen Welt für eine Gesellschaft, in der das Virtuelle immer raumgreifender wird“ interpretiert. Derartige Überlegungen knüpfen an soziologische Theorien an, wonach der physische Raum als „Kontingenzbewältiger“ fungiert und ontologische Sicherheit in einer unübersichtlichen Welt vermittelt.
Zu dieser ausgleichenden Funktion trägt die Tatsache bei, dass Bibliotheken ein Potential zur Entschleunigung innewohnt. Zuweilen werden sie zu „Refugien einer beschleunigten Zeit“ oder „Oasen des Nicht-getrieben-Seins“ erhoben. Vor allem von den öffentlichen Denkräumen scheint eine zeitenthobene Atmosphäre auszugehen, wie die Bibliothekare Caroline und Johann Leiß feststellen: „Lesesäle mit der ihnen eigenen arbeitssamen Stille sind Orte der Verlangsamung und Ruhe, die sich der Hektik des Lebens bewusst entgegenstellen.“ Die beschriebene Stimmung konstituiert sich insbesondere über die Tätigkeit der Leser und ihre Auseinandersetzung mit den Texten. Die Journalistin Anna-Lena Scholz gibt diesbezüglich zu verstehen: „Wissenschaftliches Arbeiten vollzieht sich mit ungeheurer Langsamkeit. Man muss sie aushalten können. Es gibt nur wenige Orte auf der Welt, an denen diese Langsamkeit derart wertgeschätzt wird wie in einem Lesesaal.“
Eine tröstliche Erfahrung geht überdies von der Imagination des Lesesaals als Abbildung der Welt im Sinne eines Kosmos des Wissens aus. Menschen können sich in der Bibliothek durch die Repräsentation des Lebensraums über die systematische Ordnung der Bestände und die in ihnen angehäufte Zeit ihrer Wirklichkeit versichern. Mit der Präsenz der Bücher mag der Gedanke verknüpft sein, dass im Gegensatz zur Welt die Bibliothek noch lesbar ist.

3. Der Einfluss der Raumgestaltung auf die intellektuelle Arbeit
Bibliotheken werden von zahlreichen Menschen aufgrund von Räumlichkeiten, die der gedanklichen Sammlung zuträglich sind, als Rückzugsorte aufgefasst. Der Historiker Markus Eisen ist der Meinung, dass ihre „oft mit erheblichem architektonischen Aufwand evozierten Atmosphären absoluter Konzentration oder geistiger Entspannung“ im Privaten unerreicht seien. Zweifellos wirkt die sinnlich wahrnehmbare Qualität des Bibliotheksraums auf die dort verrichteten Studientätigkeiten zurück. Milan Bulaty, ehemaliger Direktor der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin, macht darauf aufmerksam, dass eine schöne Umgebung es uns ermöglicht, tiefer zu fühlen und freier zu denken.
Welche bauliche Ausformung die Leser bevorzugen, hängt selbstverständlich von persönlichen Vorlieben ab. Als „Modi des Aufenthalts“ benennt der Betriebsdirektor der Zentral- und Landesbibliothek Berlin Jonas Fansa „anregende Weite und konzentrierte Separation“. Für letztere plädierte Leonardo da Vinci. Nach Ansicht des Universalgelehrten zerstreuen große Räume die Gedanken, während der Geist sich in kleinen Räumen sammeln kann. Dieses Argument wird gegen die Kuppellesesäle von dem einflussreichen Bibliothekar Paul Ladewig vorgebracht. Der Mitbegründer der Bücherhallenbewegung geht davon aus, dass ihre großzügigen Dimensionen konzentriertem Arbeiten abträglich seien: „Der übergroße, überhohe Lesesaal ist keine gute Lösung für das ernsthafte Studium und nicht mehr Voraussetzung des modernen Baues.“ Obendrein könne an derartigen Orten kein Gefühl von Gemütlichkeit aufkommen. „Das häusliche Behagen an einem Arbeitsplätze wächst eben so wenig mit seiner überflüssigen Größe, wie mit der schwindelnden Höhe des Raumes“, lautet Ladewigs Fazit.
Zur Verteidigung des raumgreifenden Lesesaals wurde hingegen darauf hingewiesen, dass seine Weite sowohl inspirierenden Charakter habe als auch die Möglichkeit biete, den Blick schweifen zu lassen und dadurch die Augen vom Lesen zu entspannen. Ob eine opulente Ausgestaltung der Bibliothek lernpsychologisch ratsam ist, wird allerdings in Frage gestellt. Caroline und Johan Leiß argumentieren, „[d]ass Leser sich nach […] schlichten, karg anmutenden Räumen sehnen“, da „die strenge Ordnung der Architektur, die Reduzierung auf klare Formen und Strukturen“ ein „wohltuender Rahmen für ein klares, strukturiertes Denken“ sei. Sicherlich sind Zweifel an der Allgemeingültigkeit solch generalisierender Bewertungen angebracht. Bibliotheksbesucher haben unterschiedliche ästhetische Präferenzen und fühlen sich von verschiedenen räumlichen Gegebenheiten angesprochen, von denen der nüchterne oder repräsentative Lesesaal nur eine Möglichkeit darstellt.

4. Die soziale Dimension des Lesesaals
Bibliotheken können aufgrund der Gemeinschaft der Menschen, die in ihnen arbeiten, als „Soziotope“ oder „Gesellschaftsform“ verstanden werden. Besonders trifft dies auf den Lesesaal zu, dessen soziale Dimension für einige Nutzer ein wichtiger Grund ihres Aufenthalts darstellt. Die psychologische Begründung lautet häufig, dass die Situation des Lernens und Forschens im Sichtkreis Gleichgesinnter leichter zu ertragen ist, da die Anwesenheit anderer Kopfarbeiter als motivierend und produktiv empfunden wird. Das Gefühl, sich inmitten konzentrierter Studierender zu befinden und selber gesehen zu werden, kann anspornend sein und stimulierenden Druck erzeugen. Milan Bulaty erwähnt die „ungewöhnliche, stille, nonverbale, aber wahrnehmbare Verbindung“ zu den Umsitzenden im Raum, deren „einvernehmliches Verhalten die für die eigene Arbeit notwendige Motivation und Konzentration fordert und fördert“. Der Lesesaal wird folglich insbesondere von Personen betreten, die auf der Suche nach Selbstdisziplin sind und in Arbeitsstimmung kommen wollen.
Das diffuse Hintergrundrauschen in der Bibliothek wird hierbei als anregend wahrgenommen und absoluter Stille sowie einem gänzlich sekretierten Arbeitsraum vorgezogen. Zu der Geräuschkulisse gehört nach Auffassung der Architekten Annette Gigon und Mike Guyer „jenes meditative ‚Plätschern‘ von Seiten, die umgeblättert werden, […] sacht klimpernde Laptop-Tasten, ab und an ein Räuspern, hin und wieder Flüstern und Stühlerücken“. Die Eindrücke vereinigen sich bestenfalls zu einem „unaufdringliche[n] Klangteppich, der einen der Präsenz anderer Menschen versichert, aber nicht ablenkt“. Fansa zufolge vermittelt die Bibliothek in diesem Kontext „ein Gefühl des in‐der‐Welt‐Seins, das durchaus kompensierende und tröstende Wirkung gegen die für wissenschaftliches Arbeiten typische Einsamkeit entfalten kann“. Der Lesesaal stillt ob seines ambivalenten öffentlichen wie privaten Charakters demnach ein „Bedürfnis nach gemeinschaftlichem Alleinsein“.

Über ihre eigentliche Funktion als Arbeitsraum hinaus werden Lesesäle als Begegnungszentrum und Treffpunkt genutzt. Viele der Eintretenden verknüpfen ihren Aufenthalt in ihnen mit der Erwartung des Sehens und Gesehen-Werdens. Der norwegische Bibliothekar Wilhelm Munthe beschrieb 1937 die Situation in den belebten Lesesälen amerikanischer Universitätsbibliotheken wie folgt: „Hierher kommt man, um hereinzugucken, ‚wer da ist‘, um Freunde zu treffen, […], Verabredungen […] zu machen, ein bisschen zu schwätzen, oder wohl auch einen kleinen Flirt […] fortzusetzen. Und die Lesenden sind ihrerseits nicht ernster in ihre Bücher vertieft, als daß sie nicht ein Auge auf die Kommenden und Gehenden haben können.“ Natürlich ist ein solches Verhalten der Studienatmosphäre nicht dienlich. In einer überregionalen Wochenzeitung wurde moniert, dass der Lesesaal der Berliner Staatsbibliothek zum Heiratsmarkt heruntergekommen sei und ernsthafte Forschung unmöglich mache. Vergleichbare Beobachtungen an diesem Ort teilt der Journalist Heinrich Welfing mit: „Tatsächlich kann es gelegentlich lohnender sein, die Mädchen respektive Jünglinge zu studieren als die Druckerzeugnisse. Wer je eine Weile in dieser Bibliothek gearbeitet hat, weiß, daß dort bisweilen die Kontakte schneller entstehen als die Fußnotenapparate unter Magisterarbeiten.“
Tatsächlich hält sich beharrlich die Vorstellung von der Bibliothek als Kontaktbörse. Wie Jonas Fansa hervorhebt, können ihre Räumlichkeiten als Flirtorte mit Alibi-Charakter fungieren, weil sie eine unverbindliche Umgebung bereitstellen, die vordergründig mit Studienzwecken verknüpft wird. Arbeits- und Begegnungssituation gehen hierbei zwischen Anonymität und Intimität unmerklich ineinander über.

Ein weiterer Ansporn für den Lesesaalbesuch mag das identitätsstiftende Potential von Bibliotheken sein. Mit dem Aufenthalt in ihnen ist häufig ein gewisser Stolz verbunden, einer bestimmten akademischen Kultur anzugehören. Die symbolische Aufladung des Ortes, die für die Benutzung durchzuführenden ‚Rituale‘ bzw. das Aneignen und das Sich-Einschreiben in den Raum tragen wesentlich zu diesem Empfinden bei, wie die Bibliothekssoziologin Eva-Christina Edinger erklärt. Bereits mit dem Schweigen und der Einhaltung der Regeln wird die Zugehörigkeit zu den Bewohnern des Lesesaals hergestellt. Der Arbeitsplatz bietet den Sitzenden schließlich ein Gefühl der Teilhabe. Michael Knoche erkennt, dass die Ausgestaltung des Ortes großen Einfluss auf die Identifikation mit der Institution und den in ihr Anwesenden hat: „Das alles würde nicht so gut gelingen ohne die großartige Architektur. Der Leser an seinem Platz unter der Kassettendecke mit den riesigen Kronleuchtern empfindet sich als Teil einer kulturellen Gemeinschaft, die diesen Raum deshalb so prächtig ausgestaltet hat, weil sie das Bemühen um Erkenntnis wertschätzt.“
Die vorgebrachten Argumente rechtfertigen die Bezeichnung des Lesesaals als „Soziotop“, wenn man darunter den Lebensraum einer Gruppe versteht, der für ihre Entwicklung besonders vorteilhaft ist. In der Sphäre der Lesenden und Schreibenden fühlen sich unbestreitbar zahlreiche Bibliotheksgänger aufgehoben.

Die Beeinträchtigung der Arbeitsatmosphäre im Lesesaal
Seit Bestehen des Lesesaals meldeten sich kritische Stimmen zu Wort, die auf dessen Mängel hinwiesen und ihm die nötige Aufenthaltsqualität für die intellektuelle Arbeit absprachen. Die Aversion lässt sich für den deutschen Raum u.a. darauf zurückführen, dass hierzulande die Ausleihe gegenüber dem Lesesaalbesuch traditionell eine Vorrangstellung einnimmt. Der Direktor der Königlichen Bibliothek in Stuttgart Christoph Friedrich von Stälin bemerkte 1865, dass „die Benutzung der Bücher in eigner Wohnung fast Jedermann bequemer“ sei. Hundert Jahre später schien sich an dieser Situation nach Meinung des Anglisten Helmut Bonheim wenig geändert zu haben: „Immer wieder hört man von Studenten an deutschen Universitäten, daß sie nur zu Hause arbeiten können und daß die Atmosphäre unserer Bibliotheken der geistigen Arbeit nicht förderlich sei.“
Die wenig verheißungsvolle Vorstellung, sich der Bibliotheksordnung unterwerfen zu müssen, mochte zu der Abneigung gegenüber dem Lesesaal beitragen. Der ehemalige Generaldirektor der Berliner Staatsbibliothek Antonius Jammers urteilt diesbezüglich: „Wer an seinem Arbeitsplatz auf die Tasse Kaffee, das Glas Wein oder die Flasche Bier, auf die Zigarette oder Pfeife, auf Radio- oder Schallplattenmusik nicht verzichten möchte (und offenbar werden das immer mehr), wer unabhängig von Öffnungszeiten sein möchte, der nutzt die großzügigen Ausleih- und Vervielfältigungsmöglichkeiten unserer Bibliotheken und verzichtet auf ein Arbeiten in der Bibliothek.“ Die Überwachung der Leser im Lesesaal bewog den Architekten Gregory Grämiger eine Analogie zwischen Bibliotheken und Gefängnissen zu ziehen. Besonders deutlich wird diese Entsprechung am Rundlesesaal des British Museum, der dem Schema des Panoptikums folgt, indem die Aufsichtsbibliothekare von ihrem zentralen Standpunkt aus einen Blick auf die radial aufgestellten Tischreihen werfen können. Der Medienwissenschaftler Lorenz Engell deutet den Lesesaal gar als „paradigmatische Einrichtung der Foucaultschen Disziplinargesellschaft“. Allerdings sind in den letzten Jahrzehnten die Bibliotheksordnungen vielerorts aufgeweicht worden. Auch hat der Lesesaal seine Aufsichtsfunktion inzwischen weitestgehend verloren.
Die wesentliche Ursache für den Unwillen, in größeren Bibliotheksräumen zu arbeiten, ist eher in der Beeinträchtigung der Arbeitsatmosphäre durch andere Nutzer zu suchen. Bereits 1923 beklagte Paul Ladewig die „Nummernbehandlung und Massenabfütterung“ in den Lesesälen, die „jedes abgeschlossenen Behagens entbehren“ würde. In einem Handbuchtext zur Bibliotheksnutzung wird die Kritik aufgegriffen: „Die Konzentration der geistigen Kräfte, die Quelle literarischer und wissenschaftlicher Produktion, bedarf […] der stillen Studierstube und ist in den belebten Räumen einer öffentlichen Bibliothek nicht jedem möglich.“ Offenkundig besteht ein Konfliktpotential zwischen jenen Lesern, die einer ruhigen Arbeitsatmosphäre bedürfen, und Besuchern, welche den Lesesaal als sozialen Raum begreifen. Der Buchwissenschaftler Bernhard Fabian sieht den Kern des Problems darin, dass in modernen Bibliotheken das öffentliche Element gegenüber der Möglichkeit nach Zurückgezogenheit überwiegt, weshalb einige Menschen den Lesesaal meiden würden.
Vor allem an Besuchern, die ohne primäres fachliches Interesse den Lesesaal aufsuchten, entzündete sich immer wieder Kritik. Der Direktor der Bayerischen Staatsbibliothek Philipp Lichtenthaler beschwerte sich 1851 in einem Schreiben an das Staatsministerium des Innern: „Es kommen junge Leute auf die Bibliothek, die keine andere Absicht bey diesem Besuch zu haben scheinen, als ein warmes Zimmer oder ein paar Stunden Unterhaltung zu finden.“ Die Verhältnisse erregten ebenfalls den Unmut des Bibliothekars Erich Petzet, der 1906 insistierte: „Die großen Zentralbibliotheken dürfen eben nicht als Wärmestuben überfüllt und ihrer Bestimmung ernster Arbeit entfremdet werden.“ Auf Seiten der Öffentlichen Bibliotheken spielten sozial-charitative Motive allerdings seit den Tagen der Bücherhallenbewegung eine Rolle für die Legitimation ihrer Dienstleistungen. Paul Ladewig befand deshalb, dass der Lesesaal als Wärmestube seine ernstliche Berechtigung habe.

Bibliotheken versuchen die beschriebenen Interessenkonflikte nunmehr durch Zonierung der Nutzungsbereiche zu minimieren. Entsprechend der unterschiedlichen Bedürfnisse der Besucher werden ruhige, konzentrationsfördernde Arbeitsumgebungen und Areale, die Kommunikation und Austausch dienen oder zum entspannten Verweilen einladen, ausgewiesen. Die Differenzierung der Arbeitsplätze entspricht der idealtypischen Scheidung in introvertierte und extrovertierte Bibliotheken. Während erstere mit der klassischen Lesesaalkultur assoziiert werden, entsprechen letztere dem Selbstverständnis von Bibliotheken als sozialen Integrationsorten.
Zu diesem Beitrag
Grundlage des Blogbeitrags ist eine Seminararbeit des Autors am Institut für Kulturwissenschaften / Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie an der Universität Leipzig. Seminar: Anatomie der Bibliothek und Kultur der Bibliotheksbenutzung (Dozent: Prof. Dr. Ulrich Johannes Schneider, Wintersemester 2020/21).
Christian Schrödel
Christian Schrödel studierte Informations- und Bibliothekswissenschaft und absolviert aktuell ein Master-Studium der Mittleren und Neueren Geschichte sowie der Kulturwissenschaften an der Universität Leipzig. Über sich selbst schriebt er: „Als geselliger Buchmensch, welcher der heimischen Studierkammer gerne entflieht, erblicke ich in Lesesälen mein natürliches Habitat. Dieser Lebensraum versorgt mich mit Atmosphäre, Gemeinschaft und seltenen Lesestoffen. Im Rahmen meines derzeitigen Studiums fand ich Gelegenheit, die eigene Praxis zu theoretisieren.“





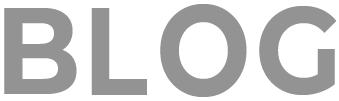
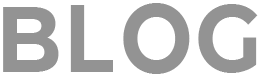
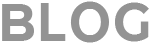
Sehr geehrter Herr Sarvari,
ja, der Beitrag von Christian Schrödel ist sehr klug und gedankenreich. Vor allem aber betrachtet der Autor doch sehr philosophisch den Bibliotheks-Lesesaal im Allgemeinen. Auch wenn er im Blog der DNB veröffentlicht wurde, beschreibt er nicht die konkreten Verhältnisse in Frankfurt/M. oder in Leipzig. Das von Ihnen kritisch Beschriebene kann mit recht beanstandet werden. Vieles ist noch ein Überbleibsel aus Zeiten, in denen sich die Menschen so gut wie möglich vor einer Corona-Pandemie schützen mussten und wollten. Für uns in der Bibliothek war es die Voraussetzung, die Lesesäle überhaupt öffnen zu dürfen. Nach und nach nehmen wir diese Schutzmaßnahmen und -vorrichtungen zurück. Manche werden aber auch bleiben, weil sie sich über die Pandemie hinaus als nützlich erwiesen haben. – Wir ändern also lieber die kritisierten Umstände als den wirklich schönen Aufsatz über „Die Lesesäle und ihre Bewohner“.
Jörg Räuber, Abteilung Benutzung und Bestandsverwaltung der Deutschen Nationalbibliothek
Vielen Dank für diesen klugen Beitrag über die Vorzüge der Lesesaalnutzung gegenüber dem privatisierten oder digitalisierten Arbeiten. Leider ist Ihr Beitrag in zumindest einem Punkt veraltet. Sie schreiben:
»Bibliotheken können aufgrund der Gemeinschaft der Menschen, die in ihnen arbeiten, als ›Soziotope‹ oder ›Gesellschaftsform‹ verstanden werden. Besonders trifft dies auf den Lesesaal zu, dessen soziale Dimension für einige Nutzer ein wichtiger Grund ihres Aufenthalts darstellt. […] [Bibliotheken können] als Flirtorte mit Alibi-Charakter fungieren, weil sie eine unverbindliche Umgebung bereitstellen, die vordergründig mit Studienzwecken verknüpft wird. Arbeits- und Begegnungssituation gehen hierbei zwischen Anonymität und Intimität unmerklich ineinander über.«
In der Deutschen Nationalbibliothek (Standort Frankfurt) sind alle Mitarbeiter vermummt und hinter Plexiglasscheiben verbarrikadiert. Reinigungsfachkräfte desinfizieren regelmäßig die Schließfachtüren. Das Café im Foyer ist mutmaßlich aus Hygienegründen dauerhaft geschlossen. In der Kantine herrscht strikte Maskenpflicht bis zur Einnahme des Sitzplatzes. Die Heizung in den Lesesälen ist gedrosselt; dafür liegen am Eingang wärmende Decken aus. Auf dem Weg zu meinem Arbeitsplatz weisen mich vier Schilder darauf hin, zwei Meter Abstand zu halten. Wer sich einen Tisch mit einem Kommilitonen teilt, um gemeinsam zu arbeiten, wird durch einen Angestellten auf Kontrollgang des Platzes verwiesen. Seine »soziale Dimension«, gar als »Flirtort«, hat die Bibliothek somit längst verloren – beziehungsweise eingetauscht gegen die Funktion, als Exerzierfeld einer unbeirrbaren Avantgarde gesundheitspolitischer Aufpasser zu dienen.
Ich bitte daher, den Artikel entsprechend zu aktualisieren.
Schöne Grüße
Es tut mir leid, dass die Realität in der Deutschen Nationalbibliothek Ihren Erwartungen und dem romantischen Bild des Lesesaals nicht entspricht. Die Veränderungen, die Sie beschreiben, reflektieren zweifellos die gegenwärtige Situation und die Priorität, die der Gesundheit und Sicherheit der Besucher und Mitarbeiter eingeräumt wird.
Jedoch könnte man argumentieren, dass diese Transformation der Bibliothek zu einem Raum der Sicherheit und des Schutzes vor den Unwägbarkeiten der Welt eine neue Form des gemeinschaftlichen Engagements darstellt. Vielleicht ist dies die aktuell gebotene Interpretation des ›Soziotops‹, in dem die Gemeinschaft sich nicht nur durch Interaktionen definiert, sondern auch durch gemeinsame Anstrengungen, um das Wohlergehen aller zu gewährleisten.
Die Dynamik mag sich geändert haben, doch die Bibliothek bleibt ein Ort des Zusammenkommens, wenn auch in einer neuen Form – eine, die weniger Raum für unbedachte Spontaneität lässt, aber dennoch ein Zentrum für den Austausch von Ideen und Wissen darstellt, wenn auch unter den Vorzeichen der Hygiene und Sicherheit.