Wissen schafft Demokratie
Die Deutsche Nationalbibliothek als Ort der Demokratie
„Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden.“
J. W. von Goethe

Die Deutsche Nationalbibliothek bewahrt an ihren beiden Standorten in Leipzig und Frankfurt am Main einen großen Schatz an Wissen: Mit Datum heute sind es 43.659.525 Medienwerke. Morgen werden es, rein statistisch gesehen, 9.313 mehr sein. Zeitungen und Kinderbücher sind ebenso dabei wie Patentschriften, Karten, Noten, Dissertationen oder Online-Publikationen – und vieles andere mehr. Ein über 400 Regalkilometer langer Fundus aus allen Wissensgebieten und Interessenslagen, zugleich eine schier unendliche Bildungsressource. Aber das Wissen zu sammeln, ist das eine. Damit es Früchte tragen kann, muss das Wissen in den Dienst der Gesellschaft gestellt werden. Dabei gibt es zahllose gesellschaftliche Anliegen an die Ressource Wissen. Eines der derzeit wohl dringlichsten Anliegen soll im Folgenden herausgegriffen und skizziert werden, welches Potenzial die Deutsche Nationalbibliothek mit ihren in 111 Jahren zusammengetragenen Medien hat – und welche Verantwortung gegenüber der Gesellschaft in ihrem gesetzlich verbrieften Sammelauftrag liegt.

Die aktuelle Demokratieforschung bestätigt, dass undemokratische und rechtsextreme Tendenzen in der Gesellschaft vor allem in einer grundsätzlich ablehnenden Haltung gegenüber der Wissenschaft und deren Ressourcen fußen. In gesellschaftlichen Umbruchs- und Krisenzeiten wie der unseren hat es der aufklärerische Gedanke, dass neues Wissen zugleich Fortschritt, Halt und Orientierung bietet und damit Zukunft sichert, schwer. Die Abwehr gegen das Neue, Fremde, Ungewohnte ist umso stärker, je weniger Sicherheiten der von Umbruch oder Krise geprägte Alltag bietet. Das Verharren in den Nischen liebgewonnener Wahrheiten aber macht anfällig für Verschwörungstheorien und andere einfache Antworten auf komplexe Fragen. Unkenntnis und Sendungsbewusstsein gehen eine fatale Allianz ein: Wer ahnungslos ist, neigt eher zu Extrempositionen, so der Sozialpsychologe Mario Gollwitzer. Dagegen hilft, Ansichten und Urteile fortwährend zu überprüfen, sie anhand neuer Erkenntnisse immer wieder infrage zu stellen und an aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen anzupassen. Ein erster Schritt in diese Richtung ist die Sammlung und öffentlichkeitswirksame Vermittlung von Wissen als Beitrag zur Stärkung der demokratischen Verfasstheit unseres Gemeinwesens. Denn Wissen schafft Demokratie.
Aber Wissen allein reicht nicht. Die 4.093 Einträge zum Begriff „Rechtsextremismus“ im Online-Katalog der Deutschen Nationalbibliothek sind ebenso reich und arm zugleich wie die 28.281 Verweise auf „Demokratie“. Denn nur, wenn wir das in den Gedächtniseinrichtungen lagernde Wissen in gemeinsame Projekte mit gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Partner*innen einspeisen, trägt es Früchte. Ziel ist es, themenzentrierte Transferleistungen zwischen Zivilgesellschaft und Wissenschaft zu unterstützen und Potenziale für Interventionen, Projekte und Ideen bereitzustellen. Dann helfen die in den Gedächtniseinrichtungen lagernden Wissensressourcen dabei, Schutzschilde gegenüber menschenverachtenden und demokratiegefährdenden Phänomenen zu ersinnen – gegen Populismus, Rechtsextremismus, Diskriminierung, Hass und andere Radikalisierungsprozesse, für Gleichberechtigung, Meinungsfreiheit, Diversität und Menschenfreundlichkeit.
Daher ist die Deutsche Nationalbibliothek mit ihren Beständen und Formaten der Bereitstellung von Wissen, aber auch mit ihren Bildungsprogrammen und Veranstaltungen eine Partnerin für Initiativen, wenn es darum geht, den lauter werdenden Demokratie-Skeptiker*innen mit ihren Rufen nach einfachen Lösungen und „klarer Ansage“ etwas entgegenzustellen.


Was konkret könnten, nein: sollten wir in diesem Kontext noch stärker in den Fokus rücken? Wenn Joachim Gauck Ende Januar im Rahmen einer Diskussion zum Thema „Demokratie als Versprechen“ im Deutschen Buch- und Schriftmuseum mit Blick auf den Wissensschatz der Deutsche Nationalbibliothek davon spricht, dass die progressiven gesellschaftlichen Kräfte heute mehr denn je angewiesen sind auf die Bereitstellung von Wissensressourcen und deren Authentizität und Autorität, so packt er den Stier bei den Hörnern: Dort, wo das Wissen „wohnt“, sollte es auch gemeinsam kuratiert und in wirksamen Dosierungen in die Welt geschickt werden, um dort Wirksamkeit entfalten zu können. Ob Veranstaltungen wie diejenigen mit Joachim Gauck zur Demokratie oder Ausstellungen zur Geschichte von Meinungsfreiheit und Zensur, ob die Beteiligung an der „Woche der Meinungsfreiheit“ des Börsenvereins, die Unterstützung von Geflüchteten oder die Leseförderung für benachteiligte gesellschaftliche Gruppen, ob Aktionen zur Diversifizierung der musealen Arbeit, die Unterstützung iranischer Grafikdesignerinnen bei ihrem Protest gegen das Regime oder die virtuelle Ausstellung zur Paulskirche als dem historischen Ort der Demokratie in Deutschland: Allein diese wenigen Beispiele aus dem Museum mögen das Potenzial andeuten, das die Deutsche Nationalbibliothek zur Förderung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit hat.

Kontextualisiertes und kuratiertes Wissen schafft Demokratie. Hier kann die Deutsche Nationalbibliothek noch stärker als Brückenbauerin in die Gesellschaft tätig werden. Denn: „Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden“ – so Johann Wolfgang von Goethe, dessen berühmter Ausspruch übrigens immer nur halb zitiert wird; der zweite Teil lautet: „…es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun“.
Stephanie Jacobs
Dr. Stephanie Jacobs ist Leiterin des Deutschen Buch- und Schriftmuseums.
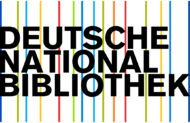



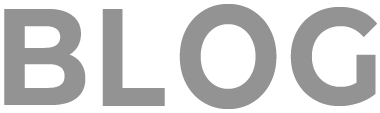
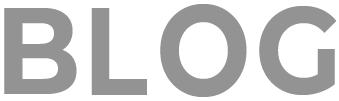
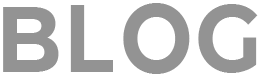
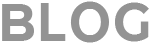
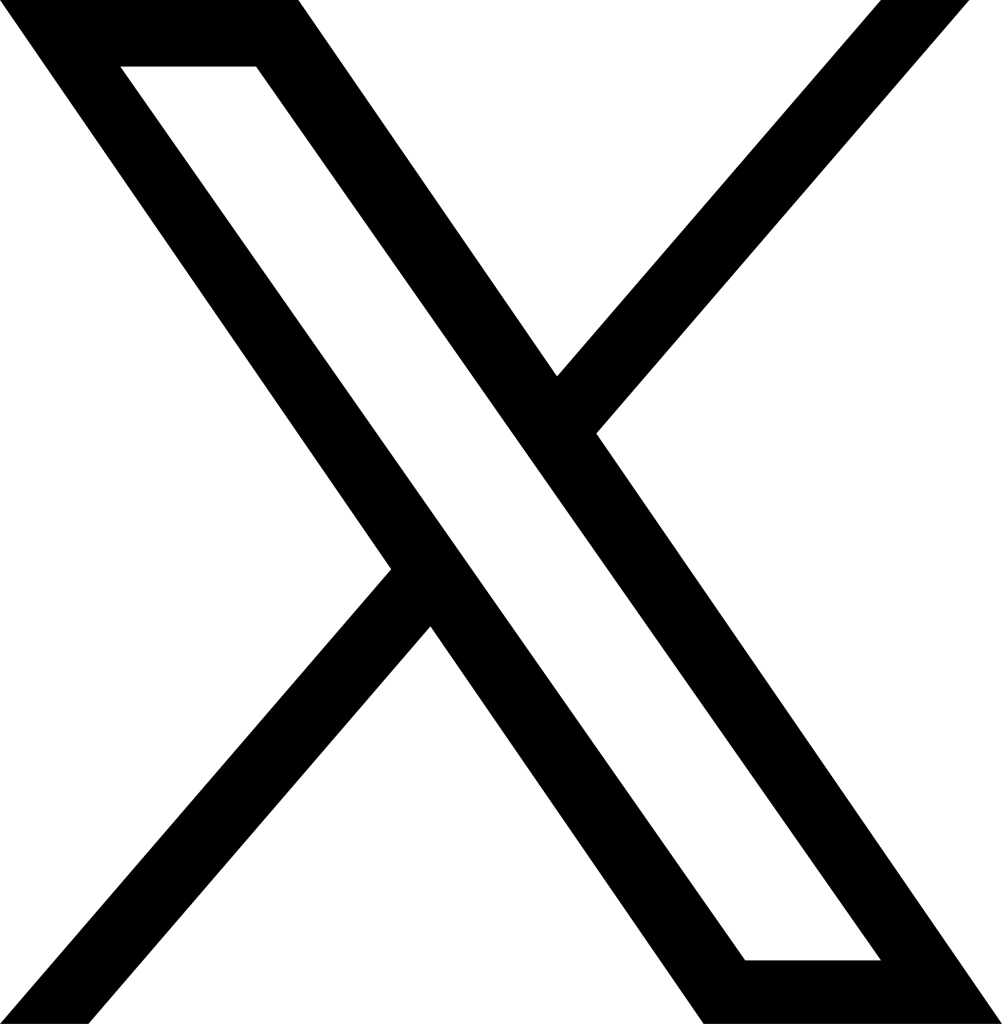
Liebe Frau Jacobs / Sehr verehrte Damen und Herren wmd … tut mir leid … Wissen allein schafft eben keine Demokratie … sondern (zunächst mal) nur wer das Wissen hat und auch den Willen entsprechend zu handeln / sich zu verhalten und selbst dann bedarf es noch der entscheidenden dritten Komponente … der Potenz … s. ‚der Geist ist willig doch das Fleisch ist schwach … Demokratie funktioniert also nur nach dem Prinzip des einverständlichen Geschlechtsverkehrs … was dabei die Liebe bewirkt … ist bei der Demokratie Bildung / Erziehung / Kultur … womit wir wieder am Anfang sind … also bei der Verantwortung dessen … der diese drei Dinge hat … Wissen / Willen / Potenz … website : http://www.die-politische-buehne.de …
Sehr geehrter Herr Möller-Voigt,
haben Sie vielen Dank für Ihre Anmerkung. Und ja: Wissen ALLEIN schafft noch keine Demokratie, aber das Wissen, das in Bibliotheken, Museen und Archiven gesammelt und gespeichert wird, in gesellschaftliche Diskurse einzuspeichern und Diskussionen aus den Gedächtniseinrichtungen heraus anzustoßen – das ist ein Ziel, das zu verfolgen lohnt. Die Brücken für das Wissen sind Bildung, Erziehung und Kultur. Aber ohne den Rekurs auf Wissensressourcen wird auch nichts aus der verantwortung fü die Demokratie, nicht wahr?
Mit freundlichem Gruß
Stephanie Jacobs
Sehr geehrte Frau Jacobs,
Ihr Projekt „Wissen schafft Demokratie“ finde ich eine sehr gute Intitiative und wünsche Ihr viel Erfolg.
Freundliche Grüße
Alfons Kaufmann, Steinäckerle 1, 73479 Ellwangen
Sehr geehrter Herr Kaufmann,
herzlichen Dank für Ihre positive Rückmeldung! Und wenn Sie mehr erfahren möchten, was wir in der Deutschen Nationalbibliothek so treiben, dann sind Sie herzlich willkommen – auch wenn Leipzig nicht gleich um die Ecke liegt…. Aber vielleicht führt Sie Ihr Weg ja einmal in den Nordosten.
Mit freundlichem Gruß
Stephanie Jacobs