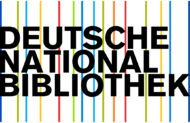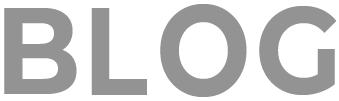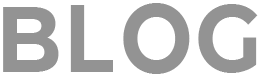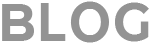Eine Klassifikation im Wandel. Kultursensibilität und die Modernisierung der DDC

„Alles fließt“ lautet ein berühmter Ausspruch des Heraklit, mit dem der griechische Philosoph darauf aufmerksam machte, dass sich die Dinge in ständiger Bewegung befinden und nichts beim Alten bleibt. Selbstverständlich gilt diese Weisheit auch für das Wissen der Menschheit und die Systeme, die versuchen, dieses Wissen abzubilden. Diese sehen sich permanent mit der Herausforderung konfrontiert, die zahlreichen Neuerungen in ein bereits vorhandenes Ordnungsschema zu integrieren. Bei Klassifikationen, wie sie in Bibliotheken für vielfältige Zwecke eingesetzt werden, ist diese Aufgabe mit besonderen Schwierigkeiten verbunden. Ihre in der Regel monohierarchische Ausrichtung macht die Integration neuer Themen schwieriger als bei verbalen Systemen, die nach Thesaurus-Konzepten organisiert sind. Erschwerend kommt hinzu, dass Klassifikationen über einen langen Zeitraum Anwendung finden sollen und die Veränderungen daher nicht so einschneidend sein dürfen, dass sie die Tektonik des Ganzen gefährden.
Im Folgenden soll ein solcher Veränderungsprozess am Beispiel der Dewey-Dezimalklassifikation (DDC) beschrieben werden, der weltweit meistverbreiteten Klassifikation, die seit 2004 auch im Bibliothekswesen des DACH-Raums eine entscheidende Rolle spielt. Im Zentrum steht dabei ein Themenkomplex, der nicht nur im bibliothekarischen Raum derzeit große Aufmerksamkeit erfährt: die kultursensible Umgestaltung der Wissensräume, die vor allem darauf abzielt, Diskriminierungen zu vermeiden.
Das Kooperationsnetzwerk hinter der DDC-Aktualisierung
Im Rahmen der kontinuierlich betriebenen Aktualisierung der DDC wurden bereits zahlreiche Maßnahmen umgesetzt, die auf eine angemessenere Darstellung kultureller Phänomene abzielen. An der Planung und Umsetzung dieser Maßnahmen sind mehrere Institutionen beteiligt. Hier ist zunächst OCLC zu nennen, die weltweit tätige Dienstleistungsorganisation für Bibliotheken, welche die DDC lizenziert und den Editionsprozess verantwortet. Die Aktualisierung der Klassifikation liegt allerdings nicht allein in den Händen von OCLC. Eine zentrale Rolle spielt das Editorial Policy Committee (EPC), ein international zusammengesetztes Beratungsgremium, das als Interessenvertretung der DDC-Nutzer*innen fungiert und die von OCLC vorlegten Änderungsentwürfe überprüft. Die Mitglieder des EPC gehören ihrerseits verschiedenen Organisationen an, die ihre Erfahrungen bei der Arbeit mit der DDC in die Diskussion einbringen. Eine dieser Organisationen ist die European DDC Users Group (EDUG), die ihre Arbeit 2007 als ursprünglich rein europäischer Zusammenschluss von DDC-Anwendern begann, der aber mittlerweile auch Mitglieder aus Kanada, Ägypten und Kolumbien angehören. Mitglieder der EDUG sind vornehmlich die zugehörigen Nationalbibliotheken. Diese wiederum sind in der Regel verantwortlich für die Übersetzungen der DDC in ihre Landessprache und somit auch dafür, dass die sprachlichen Änderungen des Originals lokalisiert übertragen werden.
Diskriminierungssensible Umgestaltung als kontinuierlicher Prozess
Wie wird nun bei der Aktualisierung der DDC der Vermeidung von Diskriminierung Rechnung getragen? Die im gegenwärtigen Diskurs wohl meist diskutierte Form der Diskriminierung ist die Verwendung von Begriffen, die von den Angehörigen bestimmter Personengruppen als beleidigend empfunden werden können. In der DDC begegnet dieses Problem vorwiegend bei den Klassenbenennungen, die deshalb immer wieder auf ihre Angemessenheit überprüft und gegebenenfalls geändert werden. Ein Beispiel hierfür ist die 2023 in der Klasse 306.778 vollzogene Ersetzung der veralteten und problematischen Bezeichnung „Transvestitismus“ durch „Fetischistisches Crossdressing“. Dass diese Änderung angebracht war, lässt sich auch daran ablesen, dass etwa zeitgleich auch in der Gemeinsamen Normdatei (GND) die Vorzugsbenennung „Transvestitismus“ in „Crossdressing“ geändert wurde.
Die Korrektur von Klassenbenennungen ist jedoch nicht die einzige Art und Weise, mit der die DDC Diskriminierungen zu beseitigen sucht. Eine wichtige Rolle spielt auch die Schaffung neuer Klassen, die dazu dienen soll, zu Unrecht marginalisierten Themen oder solchen, deren Bedeutung erst in letzter Zeit ins allgemeine Bewusstsein gerückt ist, einen Platz zu verschaffen. Ein Beispiel hierfür ist die im Jahr 2011 vollzogene Integration der Genderthematik, die auf vielfältige Weise vollzogen wurde: Neben einer Klasse, mit der fächerübergreifende Werke über die Genderthematik verortet werden können, wurden zahlreiche Unterklassen mit der Formulierung „nach Gender und Geschlecht“ geschaffen, die eine fachspezifische Klassifizierung von Genderaspekten ermöglichen. An den zahlreichen über die ganze Klassifikation verteilten Änderungen lässt sich ablesen, dass die Überarbeitung der DDC ein aufwändiger Prozess ist, da eine einzelne Entscheidung oft Konsequenzen für die Gestaltung einer Vielzahl von Klassen zur Folge hat.
Auch die Verlegung bereits bestehender Klassen kann dazu beitragen, Diskriminierungen zu beenden, die aus einer falschen Kontextualisierung von Sachverhalten resultieren. Ein gutes Beispiel hierfür ist der Umgang der DDC mit dem Themenkomplex Homosexualität im Wandel der Zeiten. In den ersten 12 Auflagen der DDC blieb Homosexualität gänzlich unerwähnt. In der DDC 13 aus dem Jahr 1932 tauchte das Phänomen erstmals auf, wurde allerdings unter „Psychische Störungen“ (Klasse 132) bzw. „Abnorme Psychologie“ (159.9) verortet. Eine Änderung wurde erst in der DDC 20 von 1989 vollzogen, in der Homosexualität im Kontext „Soziale Probleme“ (363.49) erschien. In der DDC 21 aus dem Jahr 1996 erfolgte eine Eingliederung in den Hierarchiestrang „Sozialwissenschaften / Kultur und Institutionen / Sexuelle Beziehungen“, die sichtbar macht, dass Homosexualität nun neutral bzw. ohne pejorativen Akzent als soziales Phänomen aufgefasst wird.
In ähnlicher Weise unzureichend kontextualisiert war lange auch das Thema Trans- und Intersexualität. Für die entsprechenden Personengruppen war bis zur DDC 22 keine eigene Klasse vorhanden. Sie wurden vielmehr unkorrekt unter der Hilfstafelnotation T1—0866 „Personen nach ihrer sexuellen Neigung“ verortet. Seit der DDC 23 von 2011 ist eine eigene Klasse „Transgender und Intersexuelle“ vorhanden, die der Klasse „Personen nach verschiedenen sozialen Merkmalen“ untergeordnet ist.
Die bisher erwähnten Beispiele entstammen alle dem Themenkomplex der Sexualität, aber natürlich gibt es noch viele andere Bereiche der DDC, in denen die gewachsene Sensibilität für verborgene Diskriminierungen Änderungen nach sich zog. Mitunter sind es aktuelle Ereignisse, die entsprechende Denkanstöße vermitteln. So hat etwa der russische Überfall auf die Ukraine im Jahr 2022 das Bewusstsein für deren staatliche Eigenständigkeit geschärft. Im DDC-Kontext hatte dies zur Folge, dass das schon seit langem monierte Fehlen einer eigenen historischen Gliederung für die Ukraine nun untragbar erschien. Das Land war bis dahin lediglich als „europäischer Teil der ehemaligen Sowjetunion außer Russland“ (947.5 – 947.9) behandelt worden. Seit 2024 gibt es eigene Zeitabschnitte für die Ukraine (947.701 – 941.706), die eine Auseinandersetzung mit den Besonderheiten der ukrainischen Geschichte erkennen lassen. Weitere Länder dieser Gruppe (z. B. Georgien und die baltischen Staaten) sollen bald eine analoge Behandlung erfahren.
In naher Zukunft will man sich verstärkt den gesellschaftlich vieldiskutierten Bezeichnungen für die indigenen Völker Nordamerikas zuwenden. Geplant ist eine umfassende Überarbeitung der Hilfstafeln 5 (Ethnische Gruppen) und 6 (Sprachen), wobei es vor allem um eine Reduzierung der sehr häufigen Verwendung des Begriffs „Indianer“ geht, der aktuell an 505 Stellen im DDC-Register auftaucht. Hierzu will man intensiv mit der Library of Congress zusammenarbeiten, an der Sarah R. Kostelecky, Associate Professor an der University of New Mexico und zugleich selbst Mitglied einer indigenen Gruppe, eine umfassende Sichtung des vorhandenen Wortmaterials durchführen soll. Das Grundprinzip wird die Orientierung an den Selbstbezeichnungen der einzelnen Ethnien sein.[1]
Die Darstellung der Religionen – eine besondere Herausforderung
Das vielleicht umfangreichste und wirkungsmächtigste Aktualisierungsprojekt im DDC-Kontext betrifft den Bereich der Religion. Aktuell lässt dieser Themenkomplex eine starke christliche Dominanz erkennen. Während die Klassen 230-289 ganz dem Christentum vorbehalten sind, sind alle anderen Religionen gemeinsam in den Klassen 290-299 untergebracht. Seit 2012 existiert eine optionale Anordnung als Alternative. Diese orientiert sich an einem chronologischen Modell, das die einzelnen Religionen nach ihrem Erscheinen in der Religionsgeschichte anordnet. In diesem Rahmen sind für das Christentum nur noch die Klassen 252-279 vorgesehen, was gegenüber der Standardanordnung einen erheblichen Bedeutungsverlust erkennen lässt.
Die optionale Anordnung wurde in einzelnen amerikanischen öffentlichen Bibliotheken als Standortsystematik etabliert. Seit 2024 wird darüber nachgedacht, die Standardreihenfolge ganz durch die optionale Anordnung zu ersetzen. Dieses Vorhaben war eines der Themen auf der diesjährigen Tagung der EDUG in Leiden (Niederlande). Hier wurden starke Vorbehalte gegenüber einer möglichen Umstellung erkennbar. Einerseits konnten die Teilnehmer*innen der progressiven, dem religiösen Pluralismus der Gegenwart entsprechenden Ausrichtung der optionalen Anordnung durchaus etwas abgewinnen. Andererseits kritisierte man die mangelnde Orientierung am Prinzip des „Literary warrant“: Da in Bibliotheken, welche die DDC anwenden, der Anteil der christlichen Literatur am Literaturaufkommen im Bereich Religion aktuell zwischen 60 und 70 % liegt, würde eine Anordnung, die diese Dominanz nicht berücksichtigt, zu erheblichen Verzerrungen führen. Ein anderes Problem besteht in den Folgen, welche die Anwendung der neuen systematischen Gliederung auf die in den Bibliotheken schon vorhandene Literatur hätte. Die Bestände müssten nahezu vollständig umklassifiziert werden. Da dies aber aufgrund fehlender Ressourcen nicht geleistet werden kann, ist damit zu rechnen, dass man sich mit der Ungültigkeit nahezu aller bisher in diesem Bereich vergebenen Notationen abfinden müsste.
Besonders problematisch wäre dies für Bibliotheken, die die DDC ausschließlich oder vorwiegend als Aufstellungssystematik nutzen, wie es in US-amerikanischen Schulbibliotheken und öffentlichen Bibliotheken der Fall ist. Manche würden vermutlich mit einigen Anstrengungen ihre Bestände umsortieren. Andere würden wohl aufgrund fehlender Ressourcen bei der alten Aufstellung bleiben, was zur Folge hätte, dass die Einheitlichkeit bei der Anordnung der Bestände, die eine wesentliche Qualität der DDC darstellt, verlorenginge. Anders sieht die Situation für Bibliothekssysteme aus, welche die DDC nur virtuell zur systematischen Gliederung ihrer Bestände nutzen. In Europa, wo die DDC hauptsächlich von National-, Universitäts- und Spezialbibliotheken verwendet wird, dominiert diese Form der Nutzung. Hier sind technische Lösungen denkbar, die eine Steuerung des Retrievals ermöglichen und eine weitere Nutzung der alten Erschließungsdaten sicherstellen könnten. Der hierfür nötige Aufwand wäre allerdings erheblich.
Die Diskussion wird auf verschiedenen Ebenen weitergeführt, und es lässt sich noch nicht absehen, wie sie enden wird. Sie führt vor Augen, dass progressive Veränderungsvorhaben einer pragmatisch an bibliothekarischen Gesichtspunkten ausgerichteten Nutzung entgegenstehen können. Die Umgestaltung von Klassifikationen, soviel wird hier deutlich, ist immer auch das Ergebnis von Aushandlungsprozessen und erfordert die Bereitschaft zu Kompromissen. Sie bleibt damit eine permanente Herausforderung, der sich aber alle Beteiligten im Sinne einer zeitgemäßen Gestaltung der Wissensorganisation stellen sollten, auch wenn dies zeitliche Ressourcen erfordert.
Dieser Beitrag gibt den Inhalt eines Vortrags wieder, der auf dem 9. Deutschen Bibliothekskongress 2025 in Bremen gehalten wurde.
[1] Die hier gewählte kleinteilige Vorgehensweise, bei der alle Datensätze einzeln angesehen und das Für und Wider abgewogen wird, erinnert sehr an das im DACH-Bereich von den GND-Redakteur*innen praktizierte Verfahren; vgl. hierzu den Beitrag „Wörter und ihr Gefahrenpotenzial“ im DNB-Blog.