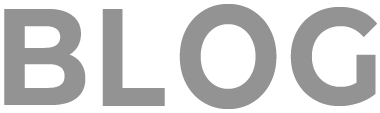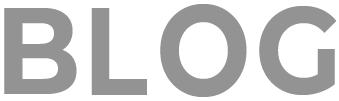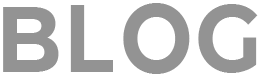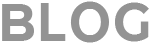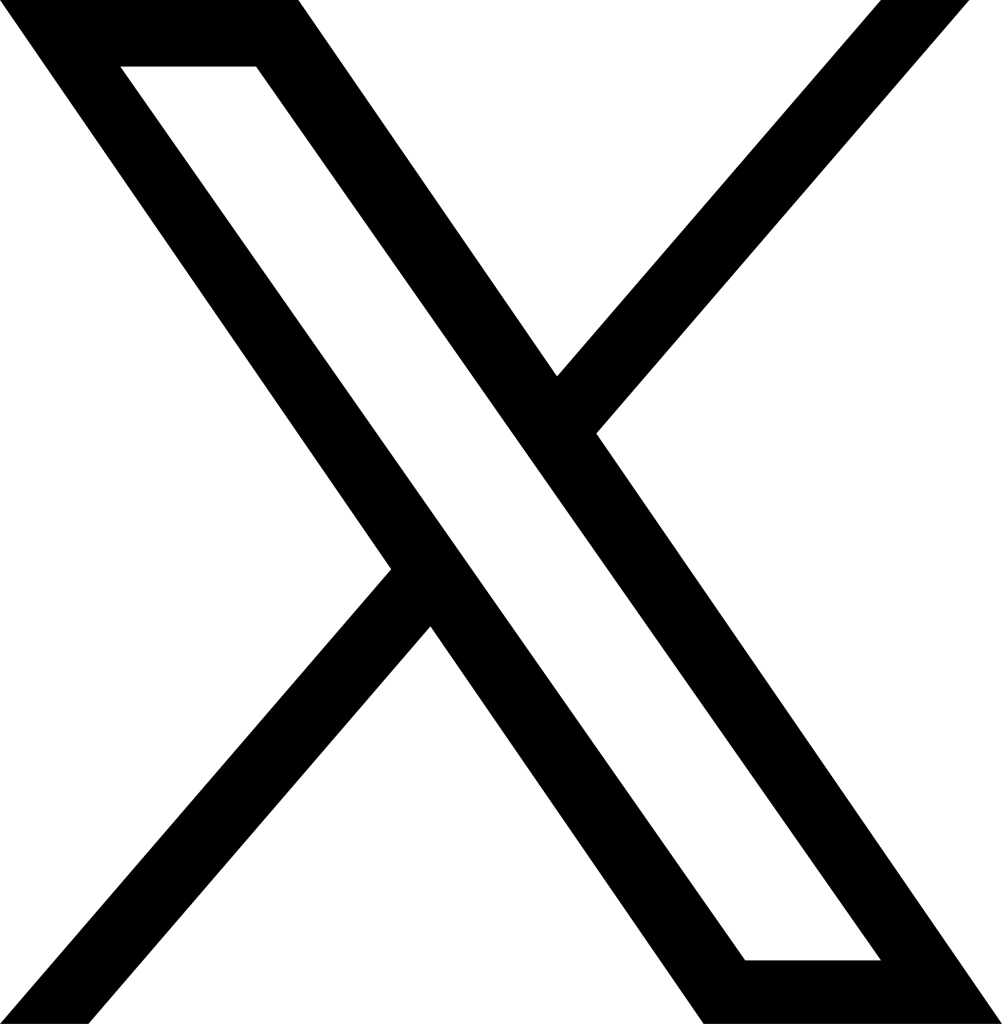Wo die Telefonbücher wohnen
Reisen wir zurück in die Zeit der 1980er Jahre, als ich frisch vereidigt meine Ausbildungszeit in der DNB (damals hieß sie Deutsche Bibliothek) in Frankfurt am Main begann. Einen Abschnitt der Fachpraktika verbrachte ich im Lesesaal der Bibliothek. Heute wie damals blickte die Bronzestatue des ersten Frankfurter Direktors, Hanns W. Eppelsheimer, gütig über die Köpfe der Benutzer*innen, Student*innen, Wissenschaftler*innen und Berufstätigen hinweg. Die für mich zuständige Kollegin – nennen wir sie Frau HW – saß neben mir am Pult der Lesesaalaufsicht (heute nennen wir dies Information, Help desk und Book a librarian) und beantwortete die Fragen der Benutzer kompetent, freundlich und, wo es angebracht war, streng. Streng war sie vor allem, wenn es darum ging, die stille, ruhige Arbeitsatmosphäre zu erhalten, die für ein vertieftes Lesen und konzentriertes Arbeiten nötig ist. Eine echte Pssst!-Bibliothekarin also. Ich wagte nur zu flüstern, der Atem ging flach.
Dann passierte das Unausweichliche – Frau HW wurde zu einem bibliothekarischen Notfall gerufen, denn nichts Geringeres hätte sie davon abhalten können, mich, als leichte Beute für forsche Benutzer, allein im Lesesaal zurückzulassen. „Ich bin wieder da, so schnell es geht“, versicherte sie mir und verschwand. Nun saß ich als Königin des Lesesaals bei Herrn Eppelsheimer und sortierte Fernleihscheine. Doch die Krone war zu groß, zum gekrönten Haupt fehlte mir die Reife.
Nach gefühlten fünf Sekunden sprach mich ein Benutzer an. Ein Herr im eleganten grauen Anzug, teuer duftend, groß und leicht gewölbt in der Mitte. Stattlich, wie meine Oma Männer vom Format Helmut Kohls bezeichnete, der damals Bundeskanzler war. Während der stattliche Herr mir wortreich erklärte, dass er dringend einige Telefonbücher für eine wichtige Forschungsarbeit benötigte, hätte ich eher eine Beschreibung aus dem Tierreich gewählt, denn wie ein Pfau sein prächtiges Gefieder auffächert, zählte der Herr alle seine akademischen Titel und Veröffentlichungen auf. Ich bat ihn, auf Frau HW zu warten. Der Herr Professor meinte, die wissenschaftliche Forschung dulde keinen Aufschub, er sei doch eigens dafür heute in die Bibliothek gekommen, und die Telefonbücher lägen nicht bereit für ihn, es dauere Stunden, bis sie kämen, wenn er sie jetzt bestelle, und das ginge ja alles gar nicht … er geriet immer mehr in Wallung, wurde laut und lauter, andere Benutzer*innen blickten genervt auf.
Man muss hinzufügen, dass das Internet damals noch als ARPANET durch amerikanische Kommunikations- und Forschungseinrichtungen geisterte, also noch nicht für die Allgemeinheit erfunden war. Der gesamte Ausleihbetrieb der Bibliothek lief manuell über Zettelleihscheine zwischen Magazinen und Lesesaal ab, viele Medienwerke befanden sich gar nicht in der Bibliothek und mussten mühsam zeitaufwändig aus Ausweichmagazinen herbeigekarrt werden. Eine Netzpublikation oder elektronische Parallelausgabe der Printmedien befand sich nur als Traum in den Köpfen digitaler Visionäre.
Der Herr Professor sah sich also in einer dramatischen Lage, zumindest überzeugte er mich und die genervte Lesesaalgesellschaft davon. Er war bleich und insistierte mit dröhnender Stimme, dass er die Telefonbücher dringend konsultieren müsse, er sei ein guter Bekannter von Frau HW und überzeugt davon, dass sie, wäre sie hier, die Dramatik der Situation erfassen und ihn mit ins Büchermagazin nehmen würde, damit ihm (und natürlich der Wissenschaft!) geholfen werde.
Dieses eine Mal im Laufe vieler Jahre ließ ich mich davon überzeugen, das Magazin mit einem Benutzer zu betreten. Dieses. Eine. Mal.
Mit flauem Gefühl im Magen überließ ich den Lesesaal dem Geist von Direktor Eppelsheimer und schritt mit dem Herrn Professor zum Lastenaufzug. Dieser Aufzug wäre heute der Schrecken unseres Inneren Dienstes, ein im wahrsten Sinn des Wortes brandgefährliches Ding, das nur an zwei Seiten Wände hatte, vorn eine Aufzugstür und hinten – nichts. Ich warnte den Herrn Professor, sich an die nicht vorhandene Wand zu lehnen und so den feinen Zwirn an der Schachtwand abzuschrubben und dadurch mit Schmutz, Öl und anderen unerquicklichen Substanzen zu kontaminieren. Dabei bemerkte ich eine zarte Röte auf seinen Wangen und die ungewöhnliche, aber begrüßenswert angenehme Stille, die ganz plötzlich von ihm ausging.
Wir kamen in dem Magazin, in dem die Telefonbücher aufgestellt waren, an. Reihe um Reihe metallener Regale voller alter vergilbter dicker Bände bis hin zu den neueren in der vertrauten sonnengelben Optik. Der Herr Professor, ein Ahnenforscher, wie er mir nun verriet, glühte freudig. Er nahm Band für Band in die Hand, scharf beäugt von mir, ob auch alles brav zurückgestellt und nichts beschädigt wurde. Hier und da schrieb er etwas in sein Notizbuch und benahm sich sehr respektvoll den Büchern gegenüber. Nach einer Weile warf ich einen betonten Blick auf die Uhr, und sofort zeigte er sich bereit, den letzten Band einzustellen und beschwingten Schritts wieder zurück zum Aufzug zu gehen. Seine Wangen waren nun definitiv rot und ich sorgte mich leicht um seinen Blutdruck. Im Erdgeschoss angelangt, wartete, ebenfalls mit hochrotem Kopf und zornig verschränkten Armen, Frau HW. Nun plagte mich eher die Furcht um meinen Arbeitsplatz, oder die unehrenhafte Entlassung aus dem Beamtendienst, falls es so etwas gab …
Doch Frau HW hatte gar nicht mich im Visier, sondern pflaumte den Herrn Professor an, wie ich es niemals von dieser distinguierten Dame erwartet hätte. Was ihm denn einfiele, hier so eine Show zu veranstalten und eine unerfahrene junge Kollegin in der Ausbildung zu drangsalieren, er wisse doch ganz genau, dass Benutzer nicht ins Büchermagazin dürften, er solle sich was schämen … etc. etc. pp. Ich applaudierte begeistert, aber stumm. Frau HW schickte den Herrn Professor, der nun leicht transpirierte und nicht mehr wie ein stolzer Pfau, sondern an ein artiges Hühnchen erinnernd neben ihr her tippelte, zurück in den Lesesaal. Mich nahm sie freundlich beiseite, erklärte mir, dass Besucher nur im Rahmen von Gästeführungen Zutritt zu den Magazinräumen bekamen, da wir eine Archivbibliothek ohne Magazin-Freihandbestand seien, die ihre Medienwerke bewahren und beschützen müsse und sie deshalb nur unter Aufsicht zur Einsicht in die Lesesaalausleihe gäbe. Ausnahmen gäbe es nicht, sonst könne ja „jeder alte Gockel kommen und sich ins Magazin einschleichen“. Ich freute mich heimlich über ihre Federvieh-Analogie und entschuldigte mich. Da sagte Frau HW, ich könne mir immerhin zugutehalten, den heimlichen Lebenstraum des Herrn Professor erfüllt zu haben, er sei ein anerkannter Forscher und wollte schon immer einmal unser Büchermagazin besuchen und schauen, wo die Telefonbücher wohnen.
Als ich die lieben alten Telefonbücher der Stadt Frankfurt am Main in unserem heutigen Magazin im Gebäude der Frankfurter Adickesallee zur Illustration dieser Geschichte fotografieren wollte, half mir ein freundlicher Kollege bei der Suche. „Stellen Sie sich vor“, sagte er mir, während wir die Regale der Kompaktusanlage auseinanderrollten, „die Telefonbücher werden immer noch ausgeliehen, manchmal ein ganzer Schwung! Meistens werden sie für die Ahnenforschung gebraucht!“
Ha!
Liebe junge Kolleg*innen in der Fachausbildung, passen Sie gut auf, dass Sie nicht den Erben des Herrn Professors auf dem Leim gehen! Und wenn diese davon träumen, einmal live die Telefonbücher (oder unsere anderen Schätze) im Magazin zu sehen, bleiben Sie eisern und verweisen bitte auf die wunderbaren Hausführungen, die die Deutsche Nationalbibliothek für Besucher*innen und Benutzer*innen anbietet!
111-Geschichten-Redaktion
Zum 111. Jubiläum haben wir, die Beschäftigten der Deutschen Nationalbibliothek, in Erinnerungen und Archiven gestöbert. Von März bis November präsentieren wir hier 111 Geschichten aus der Deutschen Nationalbibliothek.