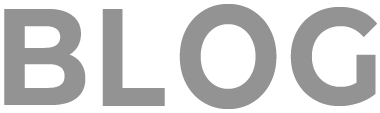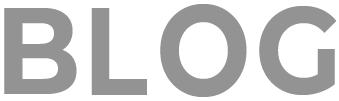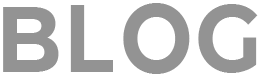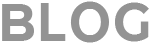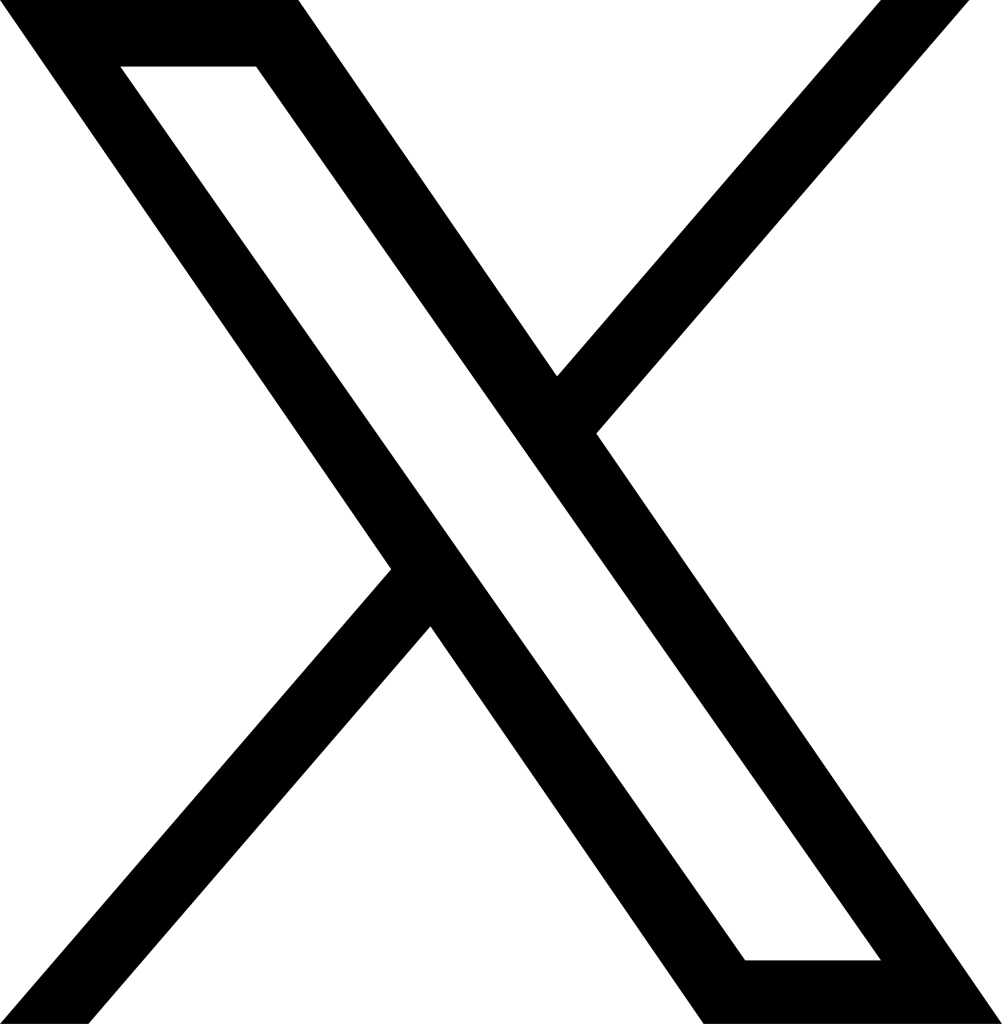Hoch, breit, tief – wenn Literatur zum Raum wird
Anlässlich der aktuellen Ausstellung „Dichtung in 3D. Textskulpturen und Gedichtobjekte seit 1960“ (5 Gründe für einen Besuch, s. Blogbeitrag) im Dt. Buch- und Schriftmuseum verfasste Prof. Heike Gfrereis vom Deutschen Literaturarchiv Marbach (DLA) einen Kommentar zu Poesie und Literatur abseits des Buches. Hoch breit, tief oder warum es so schön ist, wenn Literatur zum Raum wird:

Zeitkunst / Raumkunst
Oft betrachten wir Literatur eher als eine Zeitkunst und nicht als eine Raumkunst. Wir lesen mit der Zeit – Zeichen für Zeichen, Seite für Seite und, in westlichen Schriftsystemen, von links nach rechts und von oben nach unten. Lesen ist Fortkommen, von einem Anfang zu einem Ende gelangen, ein Buch verschlingen, in eine Geschichte eintauchen, fremde Stimmen zum Leben erwecken, andere Orte entdecken, uns vergessen.
Wer jetzt nickt, der kennt ganz sicher auch das Gegenteil. Das ziellose Blättern, kreuz und quer. Das Flimmern der Buchstaben, wenn wir über einem Buch einschlafen. Das Aufwachen, wenn es laut zu Boden fällt oder hart unter unserer Wange liegt. Das Verweilen bei einem Text, wenn wir in ihm gegen den Strich – von rechts nach links – und gegen die Zeit – von unten nach oben – Netze knüpfen und Kreise ziehen.

Dieses buchstäblich konzentrische Lesen macht aus einem Text einen (Assoziations-) Raum, hoch, breit und tief. Für mich ist es das schönste Lesen: langsam, genau, hingebungsvoll, aber eben auch offen und frei, übertrieben, auf kein Ende aus. Es liegt an mir alleine, ob ich auf einen Text so schaue, wie ich es als Kind beim Essen von Buchstabensuppe gemacht habe, um mit dem Löffel herauszulesen, was sich an Wörtern und Namen darin finden ließ, und den Tellerboden freizulegen, in dem sich das Licht des Fensters spiegelte und manchmal auch (wenn das Porzellan besonders zart war) ein Widerschein aus seiner Tiefe selbst zu kommen schien.
Honoré de Balzacs Sarrasine und Roland Barthes S/Z
Ich kann diese Lesepraxis verträumt betreiben, leichtherzig und kurzzeitig, für die Dauer eines Gedichts, aber auch exzessiv. Der französische Philosoph Roland Barthes (1915–1980) hat 1970 jeden der 801 Sätze der Novelle Sarrasine von Honoré de Balzac in „Lexien“, in „Leseinheiten“ eingeteilt und auf der Folie von fünf „Erzählcodes“ gelesen: „SYM“, der symbolische Code, „SEM“, der Code der semantischen Merkmale, „HERM“, der hermeneutische Code, „AKT“, der Code der Handlungssequenzen, und „REF“, der referentielle, aus dem kollektiven Wissen schöpfende Code. Diese „Erzählcodes“ sind Kunstgriffe, mit denen sich die „Leseeinheiten“ Schicht für Schicht abtragen lassen, aus denen diese Novelle gebaut ist, die eben nicht nur eine Handlung erzählt, sondern ihre Leserinnen und Leser in ein Netz aus Andeutungen, Anspielungen, Bedeutungen und Rätseln verwickelt.
Das klingt kompliziert und ist es auch, zeigt aber auf eine eindrückliche, anregend-anstrengende Weise eine Art des Lesens, die aus der Zeitkunst Literatur eine Raumkunst macht: „Der Text ist in seiner Masse dem Sternenhimmel vergleichbar“, so Roland Barthes in S/Z, seinem Buch über Sarrasine, „flach und tief zugleich, ohne Randkonturen, ohne Merkpunkte. So wie der Seher mit der Spitze seines Stabs daraus ein fiktives Rechteck herausnimmt (abteilt), um darin nach bestimmten Prinzipien den Vogelflug zu erkunden, zeichnet der Kommentator dem Text entlang Lektürebereiche auf, um darin die Wanderwege der Bedeutungen, die sanfte Berührung der Codes, das Vorbeigehen der Zitate zu beobachten.“ [S/Z, Frankfurt 1987, S. 18]

Literatur ästhetisch zu erfahren scheint also auch zu heißen, durch Zergliedern die schnelle Abfolge der Wörter auszubremsen und sie zu etwas zu machen, das so gegenwärtig ist, dass wir es in die Hand nehmen können. Der russische Schriftsteller Viktor Sklovskij schreibt: „Die poetische Sprache unterscheidet sich von der prosaischen dadurch, dass ihr Aufbau spürbar wird. Gespürt wird entweder ihre akustische oder artikulatorische oder ihre semasiologische Tendenz. Manchmal indessen ist nicht die Struktur der Worte, sondern ihre Aufgliederung im Satz spürbar.“ [zit. nach Boris Eichenbaum, Die Theorie der formalen Methode [1925], in: B.E., Aufsätze zur Theorie und Geschichte der Literatur, Frankfurt 1965, S. 7–52, hier S. 23].
Poetisch ist oder wird ein Text, wenn seine Elemente in räumliche Beziehungen zueinander treten, nebeneinander und hintereinander: oben und unten, rechts und links, vorne und hinten.

Goethes Über allen Gipfeln und Thomas Manns Buddenbrooks
Ich möchte dieses Lesen in 3D an einem einfachen und sehr bekannten Beispiel vorführen:
Über allen Gipfeln
Johann Wolfgang von Goethe
Ist Ruh’,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.
Die Substantive in Goethes 1780 entstandenem Gedicht, von dem überliefert ist, dass er es mit Bleistift auf die Holzwand einer Jagdaufseherhütte schrieb, stecken von oben nach unten – sowohl mit ihrer Bedeutung wie mit ihrer Stellung im Vers – eine ganze Welt ab: von den Gipfeln über die Wipfel hin zum Wald, den Vögeln und dem Ich des Gedichts, dem „Du“. Diese Sphärenharmonie entfaltet sich über die letzten Wörter in den Versen, die Reime: „Gipfeln“ und „Wipfeln“, „Ruh’ und „du“, „“Walde“ und „balde“, „Hauch“ und „auch“. Und sie breitet sich weiter aus, in die Verse hinein („Vögelein“ und das zweite „du“) bis an die Zeilenanfänge zurück: „Ist“, „Spürest“, „Warte“, „Ruhest“. Wer danach sucht, der findet in Goethes Gedicht immer mehr Ähnlichkeiten. Das „au“ von „Hauch“ etwa steckt auch in „Kaum“, das „Ru“ von „Ruhest“ umgekehrt in „nur“ und als anders getönte Vorahnung sogar schon in „Spürest“.
Markiert man alle Bedeutungs-, Klang- und Strukturähnlichkeiten, dann überzieht und unterlegt man das Gedicht mit einem Netz aus Linien – und zeichnet ein magisches Bild, denn die Sprache kann hier offensichtlich Menschen verzaubern: Dem „du“ bleibt im System des Gedichts über kurz oder lang gar nichts anderes übrig, als es der Natur gleich zu tun und ebenfalls zu ruhen. Für den Augenblick des „Warte nur“ ist der atmosphärisch-stimmungsvolle Anpassungsdruck allerdings ausgesetzt. Wie lang wir ihn ausdehnen, bleibt uns überlassen.
Lesen in 3D kann Texte in die Unendlichkeit strecken, aber auch auf einen Punkt zusammenschrumpfen lassen. Thomas Mann eröffnet seinen Roman Buddenbrooks mit einer Formel aus dem Katechismus, den die kleine Tony auswändig aufzusagen versucht: „Was ist das. – Was – ist das …“. Über viele hundert Seiten später kehrt diese drei Wörter umfassende Anfangsformel in leicht veränderter Form wieder. Ganz am Ende des Romans fragt die erwachsene, vom Leben gebeutelte Tony ihre frühere Lehrerin Sesemi Weichbrodt, ob man sich wohl im Jenseits wiedersehen werde. Sesemi antwortet, „bucklig, winzig und bebend vor Überzeugung, eine kleine, strafende, begeisterte Prophetin“: „Es ist so!“ Der Kreis ist geschlossen, in den eine ganze Welt mit ihren Enttäuschungen, Unsicherheiten und Abgründe gepackt worden ist. Was ist das. Es ist so. Der ziegelsteindicke Roman in der Nuss-Schale von Anfang und Ende.
Vom Papier über das Buch in den Raum
Schaut man sich die Literatur im Archiv an, so sieht man, dass sie nicht nur in 3D gelesen, sondern auch und immer schon in 3D geschrieben worden ist. So luftig sie mit ihren erfundenen Geschichten und illusionistischen Effekten scheint, so reproduzierbar, ort- und zeit- und eben auch raumlos sie durch den Buchdruck und ihre digitale Präsentierbarkeit ist, so körperlich und real ist sie. Ein handfestes Gegenüber. Nicht nur, dass man Gedichte als Raum auf dem Papier entwirft und Romane mit Bauplänen vorbereitet und orchestriert, koordiniert, programmiert. Ein Blatt Papier besitzt Vorder- und Rückseite, man kann es drehen und wenden und kreuz und quer beschreiben, stapeln, nebeneinanderlegen, an eine Wäscheleine hängen, an Wänden zu Bildern ordnen, auf dem Boden ausbreiten, zu Büchern binden und aus Büchern wieder ausschneiden, überkleben, durchlöchern, falten, zerknüllen.

Man kann Papier mit Wasserzeichen suchen und buchstäblich einem Text einverleiben, weil dieser dazu passt (im Deutschen Literaturarchiv zeigen Manuskripte von Friedrich Schiller, Friedrich Hölderlin und Walter Benjamin solche Epiphanie, s.o.). Man kann auf Dinge schreiben, auf Fensterläden, Tonvasen, Eier und Steine (Bsp. von Eduard Mörike in der Bildergalerie), Buchstaben, Wörter und Wortbilder ausschneiden, auf Postkarten kleben (wie Herta Müller) oder auf Poesiemaschinen (wie Hans Magnus Enzensbergers Poesieautomat, s. Abb.) oder auf Einzelkärtchen, die mit dem Zufall einer erwürfelten Zahl immer wieder neugeordnet werden können (s. Anagramm von Oskar Pastior, Abb. oben).



Der Phantasie sind – hat man erst einmal die Vorstellung überwunden, ein Blatt Papier sei eine flache Angelegenheit und Buchstaben nur etwas Schwarzes, um dem Weiß den Schrecken der Leere zu nehmen – keine Grenzen gesetzt.
Ein ABC
Die Dichtung in 3D, von Christoph Benjamin Schulz mit wundervollen Exponaten vorgestellt, erzählt also nicht nur von einer etwas anderen Geschichte der Literatur seit den 1960er Jahren. Sie ist eine Einladung an uns alle, eine literarisch-menschliche Konstante zu entdecken – unsere Freude am freien Umgang mit Sprache, Schrift und Papier, am Gestalten und Begreifen, am Denken mit und in Räumen.
Daher möchte ich zum Schluss dieser kleinen Einführung ein Alphabet der Stichwörter schenken, die Sie beim Ausstellungsbesuch als Anregung im Hinterkopf, auf der Zunge, vor Augen oder zur Hand haben könnten: A wie Antiautor(ität), B wie Bücherwurm, C wie Collage, D und W wie Drehen und Wenden, E wie Einverleiben, F wie Freiheit, G wie Geheimnis, H und J wie Hier und Jetzt, I wie Ich, K wie Körper, L wie Leuchten, M wie Material, N wie Nichts, O wie Ordnung, P wie Pause, R wie Rätsel, S wie Spielen, T wie Täuschen, U wie Untergrund und Überfluss, V wie Verdichten, Z wie Zaubern und Q, X und Y wie Aus-der-Reihe-Tanzen, Überkreuz- und Gegen-den-Strich-Lesen.
Heike Gfrereis
Prof. Heike Gfrereis ist Literaturwissenschaftlerin und Kuratorin. Am Deutschen Literaturarchiv Marbach ist sie Referentin für „Literatur im öffentlichen Raum“ und seit 2013 Honorarprofessorin an der Universität Stuttgart.