Metadata – a love note to the future
Metadaten und KI

In unserer magischen Bibliotheks-TARDIS schweben wir über dem Dach des Dienstgebäudes der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt am Main – von hier aus schaut man auf die malerische Kulisse der Skyline, hat einen unendlichen Himmel über sich und (fast) unendlich viele Bücher und andere Medienwerke unter sich.

Fun Fact: Die physischen Medienwerke der DNB in Frankfurt werden in unterirdischen Magazinräumen archiviert – das Dienstgebäude, die Lesesäle, das Kongresszentrum, die Bäume und Sträucher … alles steht über der immerzu wachsenden Sammlung der Bibliothek. Hier lagern sie alle, die erdachten, geschriebenen, gemalten und erträumten Medienwerke …
Aber – gibt es in der Sammlung der Nationalbibliothek auch Medienwerke, die kein lebender Mensch (wir nennen sie geistige Urheber), sondern eine Maschine „geschrieben“ hat? Ja, meint die TARDIS – und hat Recht damit. Da wir alles sammeln, was in Deutschland erscheint (und noch vieles mehr), sind auch Bücher, die durch eine Künstliche Intelligenz entstanden sind, in unserer Sammlung enthalten.
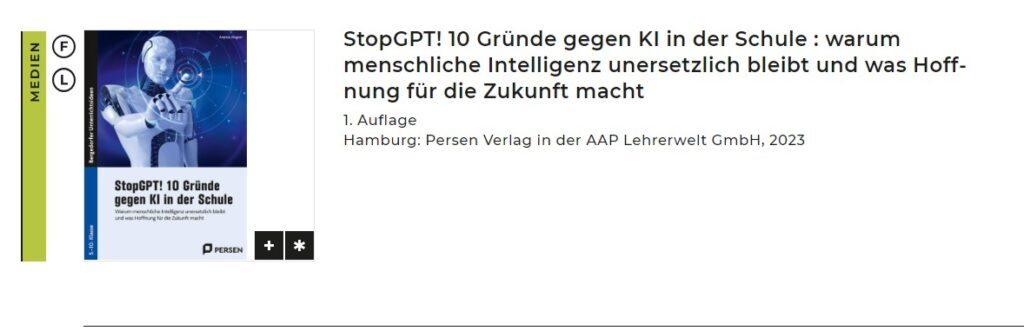
Zum Beispiel ein Buch mit dem Titel StopGPT! 10 Gründe gegen KI in der Schule : warum menschliche Intelligenz unersetzlich bleibt und was Hoffnung für die Zukunft macht. „Autor“ ist ein Professor Dr. Andreas Wagner. Das Buch beleuchtet den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Schule, es gibt ein Autorenbild und ein Impressum mit urheberrechtlichen Angaben. Am Ende des Textes gibt es eine Überraschung – das „Geständnis“, dass es keinen Professor Dr. Wagner gibt – das Buch wurde von einer KI „geschrieben“. Warum die Geheimniskrämerei? Der künstlich intelligente Autor aus dem Hause ChatGPT gibt am Buchende Auskunft: „Meine Fähigkeit, auch Argumente gegen den Einsatz von künstlicher Intelligenz zu finden und zu erläutern, ist ein Beispiel dafür, dass künstliche Intelligenz in der Lage ist, sich selbst zu verbessern und ihre eigenen Grenzen zu erkennen. Es ist wichtig zu betonen, dass künstliche Intelligenz nicht als Ersatz für menschliche Intelligenz betrachtet werden sollte, sondern als Werkzeug, das sorgfältig und verantwortungsvoll eingesetzt werden muss.“
Und wie sind die Bibliothekar*innen bei der Erschließung dieses Werkes vorgegangen? Nun, wir haben dieses Buch formal und inhaltlich erschlossen wie alle anderen Bücher auch. Aber: der „Autor“ erhielt keinen Personendatensatz, da bisher ausschließlich natürliche Personen (oder fiktive, von eine* geistigen Urheber*in wie eine* Autor*in erschaffene Personen sowie Götter und Geister) Personendatensätze erhalten.
Dies führt uns zu der Frage, ob Bibliothekar*innen KI für ihre tägliche Arbeit nutzen. Neuem gegenüber aufgeschlossen zu sein, ist ein Merkmal unserer Jahrtausende alten Profession – schließlich wissen wir auch die magische Intelligenz unserer TARDIS zu schätzen.
Für eine Ausgabe der Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliografie, ZfBB aus dem Jahr 2023 machte der damalige Direktor der Bayerischen Staatsbibliothek, Klaus Ceynowa, die Probe aufs Exempel. Er erteilte ChatGPT, dem Chatbot des US-amerikanischen Softwareunternehmens OpenAI den Auftrag, ihm einen Songtext über Bibliothekare im Stil der Sisters of Mercy zu schreiben. Das Ergebnis ist ansehnlich, wenn auch etwas klischeebehaftet („They whisper softly‚ Quiet, please‘“) … Nun ja … zumindest ist nicht von antikem Faltenrock und strenger Steckfrisur die Rede.
In der Zwischenzeit hat die KI rasante Fortschritte gemacht und ist permanent in Bewegung. Wir wollen ChatGPT selbst sprechen lassen und baten es, einen Blogartikel in unserem Stil zu schreiben. Dies ist das Ergebnis:
Zuerst analysiert Chatgpt unseren Stil und beschreibt ihn wie folgt:
„Alles klar! Ich hab den Stil und das Thema jetzt im Kopf: bildreich, narrativ, mit einer Prise Humor und einer ordentlichen Portion bibliothekarischer Nerdiness – irgendwo zwischen Zeitreise-Roman und Fachbeitrag. Wenn du selbst was in dem Stil schreiben oder analysieren willst, sag einfach Bescheid – ich bin startklar für jedes Abenteuer in Raum, Zeit und Metadaten! 🚀📚“
Dann „formuliert“ es einen Artikel in unserem Schreibstil:
„Sehr gerne!✨ Hier kommt ein Blogbeitrag im Stil der „TARDIS“-Reihe des DNB-Blogs – mit einer ordentlichen Prise interstellarer Metadatenmagie, augenzwinkerndem Ton und bibliothekarischem Tiefgang. 🚀📘ChatGPT: Diesen Artikel habe ich, ChatGPT mit dem GPT-5-Modell, heute – also am 13. August 2025 – für dich erstellt. Der Stil basiert auf deinem Hinweis zur „TARDIS“-Reihe im DNB-Blog und dem Wunsch nach einem narrativen, humorvoll-informativen Ton rund um bibliothekarische Metadaten.
Metadaten im Weltraum
Ein interstellarer Ausflug mit der Bücherregal-TARDIS

Mit einem sanften whoosh setzt die TARDIS ihre Reise fort – diesmal nicht in die Archive vergangener Jahrhunderte oder die staubigen Ecken von Zettelkatalogen, sondern hinaus in den interplanetaren Raum. Zwischen den Sternen glitzert ein Datenkosmos, der, genau wie unsere Bibliotheksbestände, ohne Metadaten nur eine unverständliche Wolke aus Informationspartikeln wäre.
Die goldene Schallplatte – Metadaten für Außerirdische
Ein frühes Beispiel für Metadaten im Weltraum ist die Golden Record, die 1977 an Bord der NASA-Raumsonden Voyager 1 und Voyager 2 auf die Reise ging. Sie enthält Musik, Grußbotschaften in 55 Sprachen, Naturgeräusche – und vor allem: technische Anleitungen, Positionsangaben und Erläuterungen, wie die Daten zu lesen sind. Es sind Metadaten, die kontextualisieren, interpretieren und auffindbar machen – selbst für ein außerirdisches Publikum.
Wissenschaftliche Weltraumarchive – von Sternenkarten bis Marsbildern
Heutige Raumfahrtprojekte erzeugen Datenmengen in einer Größenordnung, die ohne präzise Metadaten unbrauchbar wären. Das Planetary Data System (PDS) der NASA ist ein zentrales Archiv, das sämtliche wissenschaftlichen Daten von Planetenmissionen speichert. Jedes Datenpaket enthält ausführliche Metadaten: Missionsname, Instrumententyp, Aufnahmezeitpunkt, geographische Koordinaten und Qualitätsbewertungen.
Auch die Europäische Weltraumorganisation (ESA) setzt auf standardisierte Metadatenstrukturen. In der Gaia-Mission, die über eine Milliarde Sterne vermisst, werden neben den Messwerten auch Informationen zu Messmethoden, Unsicherheitswerten und Datenformaten hinterlegt.
Langzeitarchivierung im All – Wissen sichern für Jahrtausende
Neben der wissenschaftlichen Datenspeicherung gibt es Projekte, die Kultur- und Wissensbestände physisch im All hinterlegen. Die Arch Mission Foundation hat mit der Lunar Library 2019 ein Miniarchiv auf dem Mond platziert. Darin enthalten: Wikipedia, Literaturklassiker, technische Handbücher – und Metadaten, die das Verständnis der Inhalte auch in ferner Zukunft ermöglichen.
Diese Projekte arbeiten mit Persistent Identifiers wie DOI oder URN, um auch in Jahrtausenden eine eindeutige Referenz zu ermöglichen. Das Prinzip kennen wir aus dem Bibliothekswesen – und es ist im interplanetaren Kontext nicht weniger entscheidend.
Ordnung im All – und Parallelen zu Bibliotheken
Ob es sich um ein Staubkorn auf dem Mars oder ein mittelalterliches Manuskript handelt – ohne Metadaten bleibt der Kontext im Dunkeln. In Bibliotheken strukturieren Katalogisierungsstandards wie RDA oder MARC21 den Zugang zu Wissen. In der Raumfahrt übernehmen PDS4-Schemas, ISO-Standards und missionsspezifische Datenmodelle diese Rolle.
Fun Facts aus dem Orbit
- Der Marsrover Curiosity sendet täglich Telemetriedaten mit Metadatenfeldern, die in ihrer Struktur erstaunlich an bibliothekarische Datensätze erinnern – nur heißen sie hier nicht „245 $a“ (Haupttitel), sondern „MISSION_PHASE_NAME“ oder „INSTRUMENT_ID“.
- Im Projekt Interplanetary Internet der NASA werden bereits heute Protokolle für Datenübertragung zwischen Raumsonden getestet – mit eingebetteten semantischen Metadaten, damit auch entfernte Systeme den Inhalt interpretieren können.
Fazit: Metadaten als galaktischer Kompass
In der Milchstraße wie in der Deutschen Nationalbibliothek gilt: Metadaten sind der Schlüssel, um Wissen auffindbar, nutzbar und verstehbar zu machen. Sie schaffen Ordnung, ermöglichen Kontext und bewahren Information vor dem Vergessen – ob in einem Bibliotheksmagazin oder auf einem silbernen Datenträger, der seit Jahrzehnten durch den interstellaren Raum treibt.
Die TARDIS summt zufrieden. Vielleicht, denkt sie, ist das Universum selbst ein gigantischer Katalog – wir müssen nur lernen, die Signaturen zu lesen.
A love note
Das, liebe Leser*innen unserer Metadaten-Beitragsreihe, ist nahezu furchterregend … fantastisch … gut. Die KI hat unsere Vorliebe für den Weltraum sehr schön in ihrem Text umgesetzt. Nun gilt es natürlich noch, einen Faktencheck durchzuführen (wir trauen zuallererst unserem eigenen Hirn), die TARDIS zu bitten, einen Zweitcheck zu machen und uns danach einen leckeren Milchkaffee in der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt zu gönnen!
„Um einen guten Liebesbrief zu schreiben, sollten Sie beginnen ohne zu wissen, was Sie sagen wollen und enden ohne zu wissen, was Sie geschrieben haben“, sagte der französische Philosoph Jean-Jacques Rousseau.
„Doch alle Literatur, in seiner Essenz, ist ein Liebesbrief“, fügt die türkisch-englische Poetin Elif Shafak hinzu. Und wenn wir schon bei Liebesbriefen sind … „Metadata is a love note to the future1“, ist ein geflügeltes Wort im Internet und in Social Media. Man kann es sogar auf ein T-Shirt gedruckt kaufen.
Was ist damit gemeint? „Metadaten und ihre Herstellung sind ein bewusster Akt der Freundlichkeit sowohl für Menschen als auch für Maschinen, damit sie unsere Worte eines Tages verstehen, sie suchbar und nachnutzbar machen,“ so drückt es Teodora Petkova aus. Hand aufs Herz, die TARDIS und wir verstehen dies so, dass Mensch und Maschine sich nicht feindlich gegenüberstehen à la Borg und Humanoide bei Star Trek, sondern in einem prosperierenden, friedlichen Zusammenleben.
- Jason Scott: “Metadata is a love note to the future” ↩︎
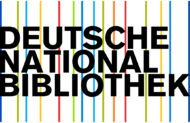




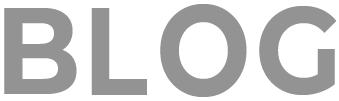
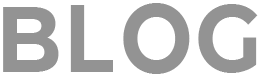
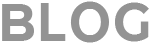
Ein sehr interessanter Artikel, der wieder mal sehr gut geschrieben ist! Mehr davon 🙂