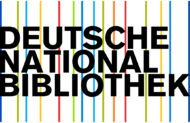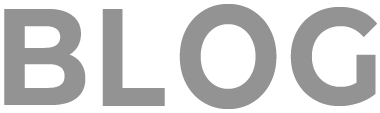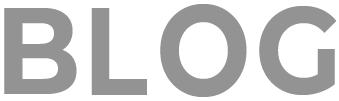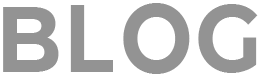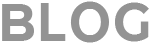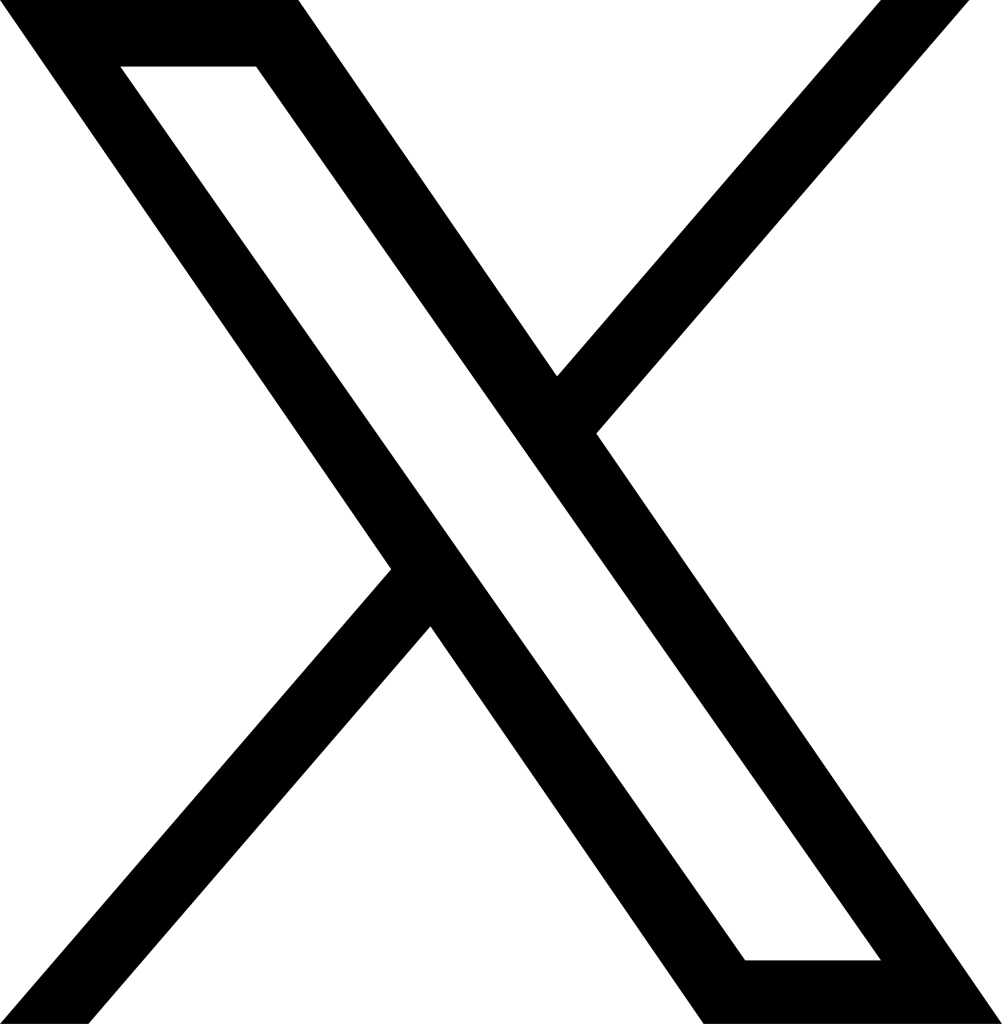Metadaten im Mittelalter

Die TARDIS passiert das Zeitportal des Mittelalters und materialisiert sich an einem Ort, der uns an die geheimnisvolle Bibliothek in Gondor erinnert, in der Gandalf der Graue der Geschichte des Einen Rings auf die Spur kommt und Galadriel das geheimnisvolle Zeichen Saurons entziffert. Im Schein einer Honigkerze treten wir näher – wir befinden uns in Bella Italia, in der Bibliothek des Klosters Montecassino, dessen Ursprünge ins Jahr 529 zurückgehen.

Bibliophile Kostbarkeiten
Literatur wird noch immer in Handarbeit hergestellt, abgeschrieben und immer weiter kopiert von emsigen Mönchen in den Skriptorien (lat. Schreibstuben) der Klöster und von Schreibern unter haushofmeisterlicher Aufsicht in herrschaftlichen Burgen. So wie die Schriftrollen eine Weile neben den Tontafeln bestanden und diese allmählich ablösten, wird nun eine neue Form von Schriftträger aktuell: der Kodex (lat. Codex für Baumstamm, Holzklotz, Buch, Heft).
Seiner Urform, einem Stapel beschreibbarer Holz- oder Wachstafeln, die die antiken Römer nutzten, ist der Kodex entwachsen. So wie der rasch brüchig werdende Papyrus von den Beschreibstoffen Pergament (auf Tierhautbasis) und Papier (ein Gemisch aus gereinigten alten Lumpen (Hadern), Hanffasern, Leinen und Nesseltuch) abgelöst wird. Als Schreibgerät dienen den Schreibern nun zugeschnittene Vogelfedern, zum Beispiel Gänsekiele, die sie in Tinte oder Farbe tauchen, um ihre Werke zu schreiben und zu illustrieren.
Der Kodex ist der Textträger, der uns am meisten vertraut ist und an unsere Bücher zuhause im 21. Jahrhundert erinnert – wenn sich die in Handarbeit hergestellten Bücher auch sehr von den heiß geliebten Taschenbuch-Krimis, Comics, Bilderbüchern oder einer liebevoll verlegten Kafka-Gesamtausgabe unserer Zeit unterscheiden.
Denn die Bücher des Mittelalters sind einzigartig und kostbar.

Um diese unikalen Schätze in ihrer Blüte zu sehen, springen wir mit der Bibliotheks-TARDIS noch ein wenig weiter in der Zeit, in das Großbritannien und Irland des Hochmittelalters. Hier finden wir nicht nur praktische, juristische und verwaltungstechnische Texte wie das Domesday Book, das König William I. nach der Eroberung Englands als frühe Form eines Grundbuchs in Auftrag gab. Vor allem religiöse, erzählerische, lyrische und sehr künstlerisch gestaltete Bücher wie das Book of Kells, das der Legende nach in einem entlegenen schottischen Kloster entstand und aus Furcht vor Wikingerangriffen ins irische Kells in Sicherheit gebracht wurde, ringen uns entzücktes Staunen ab. Die Bücher sind farbig illustriert, die Initialen (lat. Anfang), kunstvoll gemalte Anfangsbuchstaben, zeigen biblische Motive und Pflanzen- und Tiermuster, die Buchdeckel sind mit Gold, Silber, Seide, Elfenbein oder Edelsteinen verziert und so wertvoll, dass sie mit Metallschnallen und wuchtigen Schlössern versehen an die Lesepulte oder die Bücherregale gekettet werden, um sie vor Dieben und Fledderern zu schützen.

Die Metadaten der mittelalterlichen Handschriften in Kodexform verbergen sich im Incipit (lat.: Es beginnt) und im Explicit (lat. Ende, Explicit liber: Das Buch ist zuende). Das Incipit leitet den Text ein und ermöglicht, dass ein Text, der entweder keinen Titel oder schwankende Titelangaben hat, identifiziert werden kann (der Titelschutz muss erst noch erfunden werden!). Das Incipit ist der Vorläufer der Titelei, also der Titelseiten eines Buches.

Das Explicit bildet die Schlussformel des Buches und gibt Auskunft über den Ort, das Datum, den Schreiber und den Autor. Es ist oft farbig und optisch hervorgehoben und entspricht dem unverwüstlichen Kolophon, das auch in der Zeit der Salier, Staufer und der Plantagenet- und Canmore-Könige rockt.
Der Bandkatalog
Die Metadaten sind also vorhanden, aber zwischen Buchdeckeln versteckt. Wie dokumentieren, ordnen und finden die italienischen Bibliothekare und die britisch-irischen Mönche und Nonnen die Bücher in ihren Bibliothekssammlungen, ohne permanent Bücher in den Regalen zu suchen, aufzuschlagen und eventuell weitersuchen zu müssen?

Es gibt eine neue Erfindung – den Bandkatalog! Von Beginn des Mittelalters bis zum Ende des 19. Jahrhunderts tragen unsere Kolleg*innen bibliografische Daten von Büchern und Zeitschriften handschriftlich in stattliche Bandkataloge (oder Buchkataloge) ein. Wir finden auch hier Angaben über Autor*innen, Übersetzer*innen, Quellen, Standort und den Zustand der Bücher. Von Hand gebunden und optisch oft sehr schön, birgt diese Art der Datenerfassung leider einen entscheidenden Nachteil: sind sie vollgeschrieben, kann man keine Zwischeneinfügungen mehr anbringen. Selbst wenn Freiräume gelassen und sogar Zwischenseiten eingefügt wurden, sind auch diese Plätze bald ausgeschöpft und Ergänzungsbände zu den einzelnen Bänden müssen angefertigt werden, was im Laufe der Zeit zu großer Unübersichtlichkeit führt.
In unserer heutigen Zeit gelten die Bandkataloge selbst als historische Artefakte, die in den glücklichen Bibliotheken, die die besitzen, wie kleine Schätze gehütet werden.
Im Übrigen führen unsere medievalen Kollegen eine Tradition weiter: die antiken Bücherflüche, die den Zorn der Götter auf Bücherdiebe und –zerstörer heraufbeschwören, sind im Mittelalter nicht weniger krass:
„Wer Bücher stiehlt oder ausgeliehene Bücher zurückbehält, in dessen Hand soll sich das Buch in eine reißende Schlange verwandeln. Der Schlagfluss soll ihn treffen und all seine Glieder lähmen. Laut schreiend soll er um Gnade winseln, und seine Qualen sollen nicht gelindert werden, bis er in Verwesung übergeht. Bücherwürmer sollen in seinen Eingeweiden nagen wie der Totenwurm, der niemals stirbt. Und wenn er die letzte Strafe antritt, soll ihn das Höllenfeuer verzehren auf immer.“
(Inschrift in der Bibliothek des Klosters San Pedro in Barcelona)
Nachdem wir nun nicht nur durch die Zeit, sondern durch mehrere Kontinente und Klimazonen gereist sind, genießen wir eine Pause mit italienischem Cappuccino und schottischem Shortbread im Blauraum der TARDIS und wünschen uns in unser nächstes Abenteuer hinein nach … Mainz!